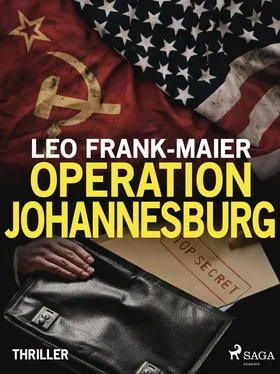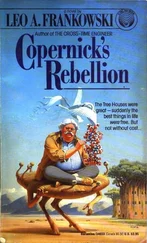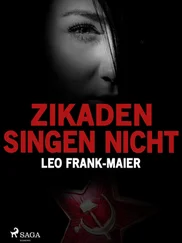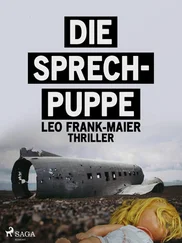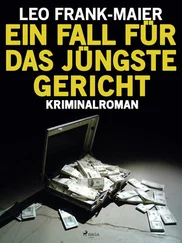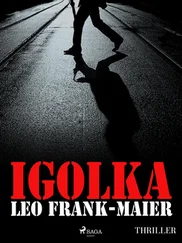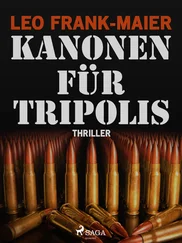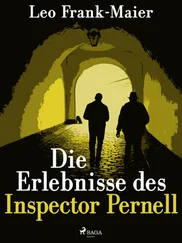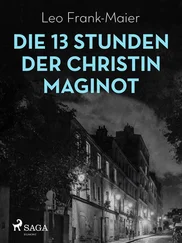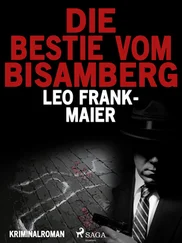Jeder in der Agency wußte, daß Jonny schon seit Jahren an einem Buch über Rassismus arbeitete. Aber das war seine höchst private Angelegenheit und ging niemanden was an. Auch nicht den Direktor. »Wird noch eine Weile dauern, Chef«, sagte er vage und das war weder die reine Wahrheit, noch war’s gelogen.
Höchst überflüssig bemerkte der Direktor, daß man heute Freitag, den 13. Juni 1980, schreibe. Das wußte sogar Jonny. Er wäre nicht abergläubisch, meinte er verständnislos. »In drei Tagen«, sagte der Direktor, »in drei Tagen jährt sich zum vierten Male dieser grauenhafte Aufstand in Soweto. Nach unseren Informationen wird es wieder blutige Rassenkrawalle und Straßenschlachten geben. Ich dachte…«
Mühsam erinnerte sich Jonny an den Namen Soweto, und daß damit ein Vorort von Johannesburg mit über einer Million farbigen Einwohnern gemeint war. »Wann soll ich fliegen«, fragte er. Der Direktor meinte, am besten noch heute.
John Bratt war viel herumgekommen, aber noch niemals in Johannesburg gewesen. Am Flughafen fragten sie ihn, ob er Feuerwaffen oder pornografische Schriften bei sich habe, und er verneinte müde. Der Taxifahrer war ein Schwarzer, aber viel mehr als »Yes, Sir« und »No, Sir« war aus ihm nicht herauszukriegen. Er nahm ein Hotel im Zentrum, es hieß »Queen Victoria« und sah auch so aus. Auf dem Nachtkästchen lag eine Bibel. John Bratt schlief erst einmal acht Stunden.
Ausgeruht und frisch rasiert strolchte er dann durch die Innenstadt. Beeindruckend. Wolkenkratzer, tiefe Straßenschluchten, moderne Geschäfte. Ein Verkehr wie in Manhattan zur Stoßzeit. John Bratt sprang hurtig von einer Verkehrsampel zur nächsten. Er sah sich die Menschen an: Schlanke Neger mit hochgezogenen Schultern, smarte weiße Geschäftsleute mit Aktenköfferchen, elegant gekleidet. Gelangweilte weiße Damen auf Einkaufsbummel, fette Negerweiber auf unglaublich dünnen Beinen. Weiß und Schwarz friedlich nebeneinander auf den Straßen, aber niemals miteinander.
Jonny wollte ein Bier trinken, das war gar nicht so einfach. Denn es gibt in Johannesburg zehnmal mehr Banken und Juweliergeschäfte als Kneipen, wo man bei einer Flasche Bier sitzen kann. Schließlich fand er eine italienische Pizzeria. Er trank Rotwein.
Auch in der Pizzeria ausschließlich weiße Gäste, nur die Kellner sind Neger. Nach dem dritten Glas will Jonny mit einem ins Gespräch kommen. Wieviel er hier so verdient, will er wissen. Der Schwarze rollt die Augen und blickt hilflos zur Kassa, wo Donna Maccaroni thront. Dann schiebt er die Schultern hoch und geht. John Bratt zahlt und geht auch. Arrivederci, sagt er zu Donna Maccaroni.
Dann ist er wieder auf der Straße, Kragen hochgestellt und Hände in den Taschen. Denn es ist kalt in Johannesburg, es ist Winter, und er bereut, keine warme Jacke mitgenommen zu haben.
Man muß genau hinsehen, ganz genau. Dann sieht man die Autobusse nur mit weißen Fahrgästen und die anderen nur mit Farbigen. »No White Only«, steht auf den Negerbussen, da darf also kein Weißer rein. Auf den Bussen der Weißen steht gar nichts. Die Schwarzen wissen ohnehin, daß es da für sie keinen Platz gibt. Auch die Haltestellen sind getrennt. John Bratt sieht auch die öffentlichen Toiletten mit der Aufschrift »nur für Weiße« und die separierten Eingänge von Geschäften, wo Likör verkauft wird. Langsam wird er grantig, nicht nur des kühlen Wetters wegen.
Ein alter Zulu bettelt ihn an, eine Münze für einen Drink will er. Ein Wunder: Ganz in der Nähe ist ein Bierladen. John Bratt wird provokant und lädt den Alten ein, mit ihm reinzugehen. Aber der ist nicht durch die Türe zu bringen. So holt John Bratt zwei Brandys in Pappbechern, und sie trinken auf der Straße. Im Nu ein Ring von Schwarzen rundherum, die aufgeregt schnattern. Die Weißen gehen vorbei. Sie machen Gesichter, als ob sie eben Kröten geschluckt hätten.
Dann steigt John in ein Taxi. Er will nach Soweto, sagt er. Der Fahrer ist ein Bure mit grobem Gesicht und ebensolchen Ausdrücken. Heute fährt er nicht zu den Kaffern, winkt er ab. Er lasse sich sein Auto nicht mit Steinen beschmeißen, von diesen Halbaffen. John steigt wieder aus. Im Hotel gibt es eine Bar, holzgetäfelt und sehr viktorianisch und der Keeper heißt natürlich George. Die Bar heißt »The Queens Arms«, und die sinnig britischen Verhaltensregeln sind an der Tür angeschlagen. Jonny liest staunend, daß es sowohl verboten ist, auf den Boden zu spucken als auch auf den Pianisten zu schießen, und daß man im übrigen eine Krawatte tragen müsse. Die smarten Gäste unterhalten sich über das Rugby-Match zwischen den › Springbocks ‹ und den ›Lions‹. Jonny fragt nach Soweto und dem morgigen Jahrestag der Rassenunruhen, aber das interessiert niemanden. George meint, Mr. Bratt muß sich keine Sorgen machen und die Polizei wäre jederzeit Herr der Lage.
Mr. Bratt trinkt vorerst einmal sieben Whisky. Er macht sich keine Sorgen um seine Sicherheit, aber um die »Queens Arms Bar«. Beim achten Whisky fragt er George, ob er jemals in Soweto war. Natürlich nicht, aber den Kaffern dort ginge es gut, und im übrigen bekämen sie in Soweto spätestens bis 1982 elektrischen Strom, das habe die Regierung versprochen. So war das also. Und niemand soll sagen, die Regierung tue nichts für die Blacks. Beim neunten Glas findet John Bratt endlich jemanden, der geneigt ist, über Soweto und die Apartheid zu reden und nicht über die › Springbocks ‹ und › Lions ‹. Der Mann heißt van Heever, ein Farmer, im Lande geboren und sehr stolz darauf.
Die Amerikaner und Europäer seien allesamt sensible Narren, findet Mr. Heever und im übrigen hätten sie keine Ahnung von den wirklichen Problemen Südafrikas und auch nicht das Recht, sich einzumischen. Die soziale Besserstellung der Blacks sei ein komplizierter und langwieriger Prozeß und ginge nicht von heute auf morgen.
Das versteht auch Jonny.
Und die Regierung tue ihr Möglichstes.
Das bezweifelt Jonny.
Noch vor zwei Jahren wäre es den Schwarzen verboten gewesen, auf den Bänken in den Parkanlagen zu sitzen. Heute dürfen sie. Sie hätten auch das Recht, zu Gericht zu gehen, wenn man sie Kaffer schimpft. Ein eigenes Gesetz wäre dafür geschaffen worden. Und die Unruhe unter den Blacks würde von außen geschürt, von kommunistischen Agenten.
»Sie können sich überzeugen, Mr. Bratt«, sagte Mr. Heever, »meinen Negern geht es gut, und sie sind auch zufrieden.«
»Ihren Negern?« fragte Jonny.
Mr. Heever meint jene, die auf seiner Farm arbeiten.
»Kommen Sie morgen zum Abendessen«, sagt er.
»Überzeugen Sie sich selber.«
Der 16. Juni 1980 ist ein Montag. Jonny hört in den Frühnachrichten von Streiks, Demonstrationen und Zusammenstößen mit der Polizei in Soweto und in der Kap-Provinz. Die Polizei habe auf Plünderer und Brandstifter das Feuer eröffnet. Acht Tote. Schwarze natürlich.
Und die ›Springbocks‹ hätten das Match gegen die ›Lions‹ überraschend gewonnen. O’Donald von den ›Lions‹ habe sich das Genick verstaucht. Ein Interview mit dem genickverstauchten O’Donald würde es im Anschluß an die Nachrichten, sagt der Radiosprecher, geben.
John Bratt schnappt sich einen Leihwagen und fährt nach Soweto. Weit kommt er nicht. Die Polizei hat die Zufahrtsstraßen abgeriegelt und kontrolliert jedes Fahrzeug. Ein Uniformierter studiert seinen Presseausweis. Er solle wieder zurückfahren und sich hier nicht wichtig machen, sagt er mißmutig. An den Straßenrändern hängen Trauben von jugendlichen Schwarzen. Sie schreien und lachen und das Ganze ist für sie offenbar ein Riesenspaß. John sieht, wie seine Berufskollegen und Kamerateams mit den Schwarzen verhandeln, wie sie ihnen Münzen zustecken und Zigaretten. Dafür müssen die Schwarzen dann ordentlich heulen und Fäuste schütteln und ein wenig mit Steinen schmeißen.
Читать дальше