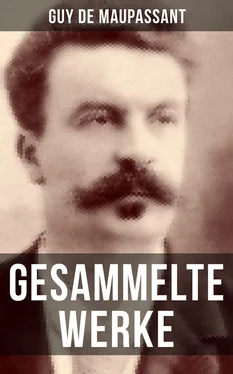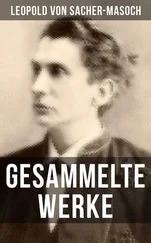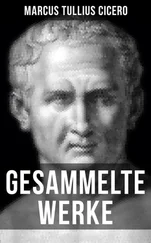Er setzte sich, schlug die Beine übereinander und zupfte an den Spitzen seines Schnurrbartes, wie er das in den Stunden der Sorge, der Langweile und des schweren Nachdenkens zu tun pflegte.
Madeleine griff nach einer Stickerei, an der sie hin und wieder arbeitete;, suchte die Wollfäden heraus und sagte:
»Ich habe nur stillzuschweigen. Du mußt dir die Sache überlegen.«
Lange saß er schweigend da, dann versetzte er zögernd:
»Die Welt wird nie begreifen können, daß Vaudrec dich zu seiner Universalerbin eingesetzt hat und daß ich so etwas geduldet habe. Solch ein Vermögen auf so eine Weise anzunehmen, das würde einem Geständnis gleichbedeutend sein … Du würdest deinerseits ein verbotenes Verhältnis zugeben und ich eine niederträchtige Schwäche … verstehst du, wie man unsere Annahme auslegen würde? Man müßte einen Ausweg finden, irgendein geschicktes Mittel, wie man die Sache vertuschen könnte. Man könnte beispielsweise durchblicken lassen, daß er sein Vermögen uns zu gleichen Teilen vermacht hat, die eine Hälfte dem Manne, die andere der Frau.«
Sie fragte:
»Ich sehe nicht ein, wie das zu machen wäre, da doch das Testament eine gesetzliche Kraft hat?«
»Oh, das ist ganz einfach,« antwortete er, »du könntest mir die Hälfte der Erbschaft als Schenkung zu Lebzeiten übertragen. Wir haben keine Kinder, das geht sehr gut zu machen. Auf diese Weise würden wir dem böswilligen Gerede ein Ende bereiten.«
Sie erwiderte etwas ungeduldig:
»Ich sehe nicht ein, wieso man dem böswilligen Gerede entgehen kann, da doch die Urkunde, die Vaudrec unterzeichnet hat, nicht wegzuleugnen ist.«
»Wir brauchen sie doch gar nicht vorzuzeigen«, rief er zornig aus, »und sie öffentlich an die Wand zu schlagen. Du bist zu dumm. Wir sagen, Graf de Vaudrec hat sein Vermögen uns beiden zu je einer Hälfte hinterlassen … Weißt du, du kannst doch die Erbschaft ohne meine Zustimmung überhaupt nicht antreten. Ich gebe sie dir nur unter der Bedingung einer Teilung, die mich vor dem Gespött der Welt bewahrt.«
Sie sah ihn mit einem durchbohrenden Blick an.
»Wie du willst, ich bin bereit.«
Dann stand er auf und ging wieder auf und ab, er schien wieder zu schwanken und vermied jetzt den scharf beobachtenden Blick seiner Frau.
»Nein, in keinem Fall« sagte er. »Vielleicht soll man überhaupt verzichten … es ist würdiger, korrekter, ehrenhafter … Übrigens auf diese Weise könnte man uns auch nicht das Geringste nachsagen. Die gewissenhaftesten Leute könnten sich nur davor verbeugen.«
Er blieb vor Madeleine stehen.
»Also schön, wenn du willst, gehe ich nochmals zu Lamaneur, ich setze ihm die Sache auseinander und frage ihn um Rat. Ich erkläre ihm mein Bedenken und teile ihm mit, daß wir uns zu einer Teilung entschlossen haben, um die Leute nicht über uns klatschen zu lassen. Von dem Augenblick an, wo ich die Hälfte der Erbschaft annehme, ist es ja selbstverständlich, daß niemand das Recht hat, über die Sache zu lächeln. Das würde mit anderen Worten heißen: Meine Frau nimmt die Erbschaft an, da ich, ihr Gatte, sie auch annehme, und als solcher habe ich zu bestimmen, was sie tun kann, ohne sich zu kompromittieren. Sonst hätte es ja einen Skandal gegeben.«
»Wie du willst«, murmelte Madeleine einfach.
Er redete weiter:
»Ja, bei dieser Teilung der Erbschaft in zwei Hälften liegt die Sache sonnenklar. Wir beerben einen Freund, der keinen Unterschied zwischen uns machte, keinen von uns bevorzugte und nicht den Schein erwecken wollte, als meinte er: ‘Ich gebe nach meinem Tode einem von beiden den Vorzug, wie ich ihn zu meinen Lebzeiten vorgezogen habe.’ Er liebte mehr die Frau, wohlverstanden, aber wenn er jetzt sein Vermögen beiden Gatten zu gleichen Teilen hinterläßt, so wollte er damit ausdrücklich bestimmen, daß die Bevorzugung rein platonisch war. Sei überzeugt, daß, wenn er nachgedacht hätte, er geradeso gehandelt hätte. Er hatte sich die Sache nicht überlegt und die Folgen nicht vorausgesehen. Du sagtest vorhin ganz richtig, er brachte dir jede Woche Blumen mit und dir galt auch sein letztes Andenken, ohne daß er sich überlegte …«
Sie unterbrach ihn etwas gereizt und ungeduldig:
»Schon gut. Ich hab’ es begriffen. Du kannst dir die Erklärungen ersparen. Geh gleich zum Notar.«
Er wurde rot und stotterte:
»Du hast recht, ich gehe.«
Er nahm seinen Hut und sagte beim Weggehen:
»Ich werde versuchen, den Neffen mit fünfzigtausend Francs abzufinden, nicht wahr?«
»Nein,« antwortete sie stolz, »gib ihm die hunderttausend Francs, die er verlangt. Nimm sie von meinem Teil, wenn du willst.«
Plötzlich schämte er sich und sagte:
»Nein, wir werden uns das teilen. Wenn jeder von uns fünfzigtausend Francs gibt, dann bleibt uns doch eine runde Million.«
Dann fügte er hinzu:
»Auf Wiedersehen, meine kleine Made.«
Er ging zum Notar, erklärte und setzte ihm seine Absichten auseinander, die, wie er behauptete, von seiner Frau ausgingen.
Am folgenden Tag unterzeichneten sie eine Schenkung zu Lebzeiten von fünfhunderttausend Francs, die Madeleine Du Roy ihrem Gatten abtrat. Dann, als sie das Bureau verlassen hatten, schlug Georges Du Roy vor, bei dem schönen Wetter einen Spaziergang zu machen. Er war sehr liebenswürdig und aufmerksam gegen seine Frau. Er sah außerordentlich vergnügt aus und lachte, während sie nachdenklich und etwas ernst blieb.
Es war ein kühler Herbsttag. Die vorübergehende Menge schien es eilig zu haben und die Passanten schritten hastig dahin. Du Roy führte seine Frau vor den Laden, in dessen Schaufenster er den Chronometer bewundert hatte.
»Willst du, daß ich dir eine Schmucksache kaufe?« fragte er. Sie murmelte gleichgültig:
»Wie du willst.«
Sie traten in den Juwelierladen herein. Er fragte:
»Was willst du, ein Kollier, ein Armband oder ein Paar Ohrringe?«
Beim Anblicken der Schmuckstücke und Juwelen konnte sie ihre absichtlich angenommene kühle Haltung nicht mehr bewahren und ihre Augen liefen funkelnd und neugierig über all die Kostbarkeiten in den Glaskästen.
Und plötzlich rief sie vom Verlangen ergriffen:
»Sieh, da liegt ein schönes Armband!«
Es war eine eigenartig geformte Kette. Jedes einzelne Glied trug einen anderen Stein.
Georges fragte:
»Was kostet dieses Armband?«
»3000 Francs«, erwiderte der Juwelier.
»Wenn Sie es mir für zwei fünf lassen, so ist das Geschäft gemacht.«
Der Verkäufer zögerte; dann versetzte er:
»Nein, mein Herr, das ist unmöglich.”
Du Roy fuhr fort:
»Also dann geben Sie mir den Chronometer für 1500 Francs dazu; das macht zusammen 4000, die ich Ihnen in bar bezahle. Einverstanden? Wenn Sie nicht wollen, gehe ich woanders hin.«
Der Juwelier war verdutzt und sagte schließlich zu.
»Also gut, mein Herr.«
Der Journalist gab seine Adresse und fügte hinzu:
»Auf den Chronometer lassen Sie meine Initialen G. R. C. in verschlungenen Buchstaben eingravieren, und darüber setzen Sie die Baronskrone.«
Madeleine lächelte überrascht. Und als sie hinausgingen, schmiegte sie sich mit einer gewissen Zärtlichkeit an seinen Arm. Sie fand ihn wirklich schlau, gewandt und stark. Jetzt, wo er ein Vermögen hatte, mußte er auch einen Titel haben. Das war recht und billig.
Der Juwelier verbeugte sich.
»Sie können sich darauf verlassen, es wird Donnerstag fertig sein, Herr Baron.«
Sie gingen am Vaudeville vorbei. Dort wurde ein neues Stück aufgeführt.
»Wenn du willst, gehen wir heute ins Theater, ich werde sehen, ob wir eine Loge bekommen?«
Sie fanden eine Loge und nahmen sie. Er sagte weiter:
»Wie wäre es, wenn wir heute im Restaurant äßen?«
»Oh, bitte, das möchte ich sehr.«
Читать дальше