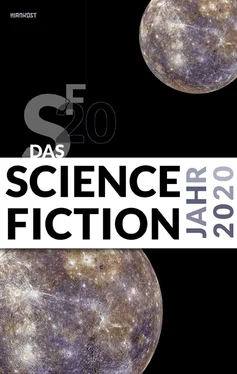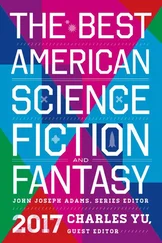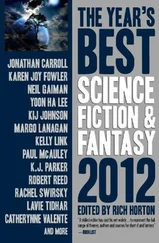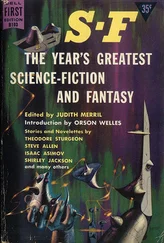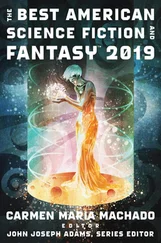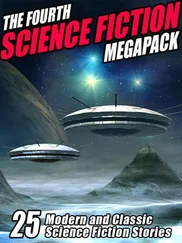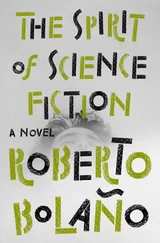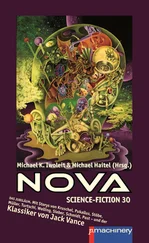Eine aktuellere Figur ist Samir Abboud in der 2018 ausgestrahlten ersten Staffel der Serie ALTERED CARBON – DAS UNSTERBLICHKEITSPROGRAMM, der Serienadaptation des Romans von Richard Morgan. Samir wird von dem amerikanischen Schauspieler mit palästinensischer Migrationsgeschichte Waleed Zuaiter verkörpert. Samir ist Polizist im 24. Jahrhundert und der Dienstpartner der Hauptprotagonistin Kristin Ortega beim Bay City Police Department. Er spricht hin und wieder Arabisch, erwähnt Allah und wird von einer Christin, die ihm sehr nahesteht, als eine Person definiert, die an einen anderen Gott glaubt als sie selbst. Ungefähr in der Mitte der ersten Staffel opfert er sein Leben, als er sich schützend zwischen seine Partnerin Ortega und eine tödliche Kugel wirft. Samir existiert nicht im Roman und wurde eigens für die Serie erschaffen, die somit eine weitere Dimension von kultureller und religiöser Diversität erfährt. Die Figur wird durchweg positiv als eine väterliche, milde und behutsame Person dargestellt, verschwindet allerdings zu schnell von der Bildfläche. Sein Tod stellt den gewohnten Status quo der uniformen Gesellschaft ohne den kulturell und religiös fremdempfundenen »Anderen« wieder her. In Anlehnung an die Trope des »Bury Your Gays« – wer sich auf gleichgeschlechtliche Liebe einlässt, nimmt kein gutes Ende – kann hier auch von »Bury Your Muslims« die Rede sein.
Deutschsprachiger Mikrokosmos
Gehen wir vom großen Mainstream zur aktuellen deutschsprachigen Science Fiction, sind muslimische Figuren nicht minder rar gesät. In seinem Near-Future-Hörbuch Neopolis – Die Stadt aus Licht, das dieses Jahr erschien und im Jahre 2048 spielt, bedient sich der Autor Karl Olsberg an Saudi-Arabien als Kulisse und baut einen Thriller um das Thema der Augmented Reality mit der islamischen Mythologie als Kernelement – wobei die Muslim*innen als klischeehafte Randfiguren fungieren. Judith und Christian Vogt vermengen in ihrem 2019 erschienenen Hopepunk-Roman Wasteland, der in einem futuristischen Deutschland nach einer Apokalypse im Jahre 2064 spielt, Redewendungen in diversen Sprachen zum Allgemeingut der Überlebenden, sodass inşallah, Allah-weiß-wohin, (Aman) Allahım und maşallah Teil einer englisch-deutsch-türkisch durchdrungenen, als alltäglich und normal empfundenen neuen Sprache werden. Zudem betet die Protagonistin Laylay zu Allah. Im Rollenspiel Aces in Space, das dieses Jahr von Harald Eckmüller und ebenfalls von den Vögten herausgebracht wurde, gibt es sogar eine mit Kopftuch illustrierte muslimische Archetypin: die Influencerin. Das 2018 ins Deutsche übertragene Rollenspiel Coriolis – Der dritte Horizont baut in seinem Space-Opera-Setting fast ausschließlich auf islamische und nahöstliche Mythologie auf. Dass die Vorfahren aller in der Zukunft überlebenden Menschen aus dem Nahen Osten stammen, spiegelt sich weitestgehend frei von Exotik in jeglicher Form des kulturellen Alltags wieder – von Namensgebung über Kleidung bis zu sozialen Gepflogenheiten.

Appell/Frust/Fazit
Diese Aufzählungen, insbesondere im deutschsprachigen Raum, mögen optimistisch stimmen, trotzdem sind das nur erste wackelige Schritte in der Repräsentation von Muslim*innen, die im westlichen Mainstream quasi nicht existent ist. Sie bleibt nicht im Gedächtnis haften und glänzt mit einer ausufernden Abwesenheit – so prägt es sich auch ins (pop-)kulturelle Gedächtnis der Rezipient*innen wie auf dem eingangs gezeigten Bild ein: »In der Zukunft gibt es keine Muslim*innen.« Vielleicht ist es ja an der Zeit, in einen der zukünftigen STAR TREK-Ableger einen muslimisch konzipierten Sufi-Vulkanier zu implementieren – schließlich kennt Science Fiction bekanntlich keine Grenzen!
Literatur:
Gerbner, Georg & Larry Gross: »Living with Television: The violence profile«. In: Journal of Communication, 1976. S. 172–199.
Hafez, Farid: »Antimuslimischer Rassismus und Islamophobie: Worüber sprechen wir?«. In: Uçar, Bülent & Wassilis Kassis (Hrsg.): Antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit. V&R unipress: Göttingen, 2019. S. 57–75.
Hulan, Haley: »Burry Your Gays: History, Usage, and Context«. In: McNair Scholars Journal, Vol. 21, No. 1, S. 17–27.
Kanzler, Katja: »›Khan!‹ – Verfremdung und Serialität als Modi politischer Reflexion in Star Trek«. In: Besand, Anja (Hrsg.): Von Game of Thrones bis House of Cards – Politische Perspektiven in Fernsehserien. Springer VS: Wiesbaden, 2018. S. 71–85.
Merz, Sibille: »Islam«. In: Arndt, Susan & Nadja Ofuatey-Alazard (Hrsg.): (K)erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache – Ein kritisches Nachschlagewerk. Unrast: Münster, 2015. S. 365–377.
Reeves-Stevens, Garfield & Judith Reeves-Stevens: Star Trek, Deep Space Nine – Die Realisierung einer Idee. Heyne: München, 1996.
Reiss, Frank: »Wofür wir eine bessere Repräsentation von Vielfalt im Pen & Paper-Rollenspiel brauchen«. In: Vogt, Judith, Frank Reiss & Aşkın-Hayat Doğan (Hrsg.): Roll Inclusive – Diversität und Repräsentation im Rollenspiel. Feder & Schwert: Köln, 2019. S. 9–29.
Judith C. Vogt
Die drei Geschlechter: Männer, Frauen und Aliens
Nichtbinäre Geschlechter in der Science Fiction
Ihr kennt es vielleicht auch: Das witzige Toilettentürschild mit dem Strichmännchen in Hose, dem Strichmännchen im Kleid und dem Alien. Vielleicht noch versehen mit einem: »Egal, Hauptsache, du wäschst dir die Hände«. Auf den ersten Blick gibt es natürlich nichts daran auszusetzen, die Aussage ist sonnenklar. Und dennoch steht dieses Kloschild sinnbildlich für eine Weltordnung, in der Menschen in genau zwei Geschlechterschubladen gesteckt werden und alle Abweichung als fremd oder gar unnatürlich markiert wird. Diese Weltordnung zeigt sich, wie alle Elemente unserer Gegenwart, auch in der Science Fiction. Doch so, wie Geschlechterrollen und -identitäten diskutiert, in neue Worte gefasst und aus anderen Blickwinkeln betrachtet werden, ist »Gender« auch in der Science Fiction im Wandel und auf dem Weg zu einer neuen, menschlicheren Repräsentation einer auch in dieser Hinsicht vielfältigen Gesellschaft. Damit hat Science Fiction, wenn sie es richtig macht, vielleicht literarisch eine ungeahnte Bandbreite an Möglichkeiten, die nur darauf wartet, genutzt zu werden.
Schubladen fürs Denken
Die obersten Kategorien für Menschen sind »männlich« und »weiblich«. Das ist als vermeintlich neutraler Fakt in unseren Köpfen verankert, und beim Entwerfen einer Romanfigur stellt sich Schreibenden zuallererst die Frage: Ist meine Figur weiblich oder männlich? Unsere Gesellschaft sagt uns seit Tausenden von Jahren, dass das die beiden möglichen Kategorien sind. Alles darüber hinaus, selbst wenn es soziologisch, biologisch und psychologisch unterfüttert wird, macht vielen von uns schlichtweg in seiner Komplexität Angst. Und nicht nur das: Das Konstrukt von einem fundamentalen und augenscheinlichen Unterschied zwischen den beiden als einzig »gültig« angesehenen Geschlechtern ist ein Narrativ, das dazu dient, eine der einfachsten Hierarchien in unserer Gesellschaft und unserer Geschichte zu zementieren. Wenn es zwei Geschlechter gibt und diese fundamental und angeboren verschieden sind, müssen sich auch ihre Aufgaben in der Gesellschaft klar unterscheiden. Die einen bekommen die Kinder, die anderen bekämpfen den Säbelzahntiger, so lautet die Geschichte, die wir uns erzählen. Bestrebungen, etwas anderes als das sichtbar zu machen, bedrohen diese Erzählung. Sie erschweren es, eine Machtposition aufrechtzuerhalten und auszuüben.
Diese Geschichte versucht in all ihren Aspekten, sich auf vermeintliche Natürlichkeit zu stützen. Wer hat welche Chromosomen? Wer hat welche Reproduktionsorgane? Eine Einteilung in männlich und weiblich – so wird uns gesagt – ist der natürliche Urzustand. Auf dieser Basis ziehen wir gefährliche Schlüsse: Diesen Status quo infrage zu stellen, ist ein Aufbegehren gegen die menschliche Natur. Es ist künstlich, unnatürlich, vielleicht sogar ein »Hype«. Aber was, wenn dieser Status quo gar nicht der natürliche Urzustand ist, sondern einfach nur eine besonders erfolgreiche Erzählung?
Читать дальше