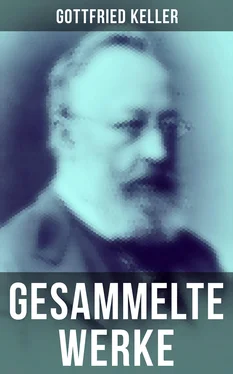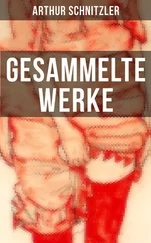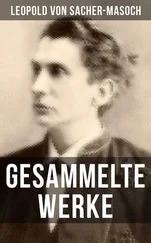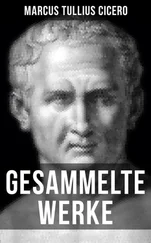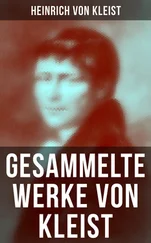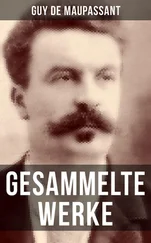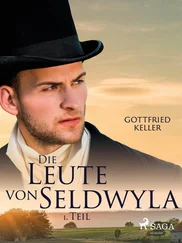Inhaltsverzeichnis
Er verschwieg dies sorgsam vor seiner Mutter, schrieb ihr aber auch nicht, daß er etwas erwerbe, da es ihm nicht einfiel, sie anzulügen, und da es ihm in der Tat bei seiner Sorglosigkeit und seinem sichern Gefühl, daß er schon etwas werden müsse und würde, ganz gut erging, so berichtete er der Mutter in jedem Briefe, es ginge ihm gut, und erzählte ihr weitläufig allerlei lustige Dinge, die ihm begegneten oder welche er in dem fremden Lande beobachtete. Die Mutter hingegen glaubte echt frauenhaft, wenn man von einem Übel nicht spreche, so bleibe es ungeschehen, und hütete sich, ihn nach etwaigen Schulden zu befragen, in der Meinung, daß wenn solche noch nicht vorhanden wären, so würden sie durch diese Erkundigung hervorgerufen werden; auch hatte sie keine Ahnung davon, daß ihr Söhnchen, welches sie so knappgehalten hatte, in seiner Freiheit etwa so lange Kredit finden würde. Sie hielt ihre Ersparnisse fortwährend bereit, um sie auf die erste Klage teilweise oder ganz abzusenden, während Heinrich seine Lage verschwieg und sich an das Schuldenwesen gewöhnte, und es war rührend komisch, wie beide Teile über diesen Punkt ein feierliches Schweigen beobachteten und sich stellten, als ob man von der Luft leben könnte; der eine Teil aus Selbstvertrauen, der andere aus weiblicher Klugheit.
Gerade mit einem Jahreslaufe ging aber Heinrichs Kredit zu Ende oder vielmehr bedurften die Leute ihr Geld, und in dem Maße, als sie ihn zu drängen anfingen und er höchst verlegen und kleinlaut war, wurden auch seine Briefe seltener und einsilbiger, so daß die Mutter Angst bekam, die Ursache erriet und ihn endlich zur Rede stellte und ihm ihre Hilfe anbot. Diese ergriff er nun ohne besondere dankbare Redensarten, die Mutter sandte sogleich ihren Schatz ab, froh, zur rechten Zeit dafür gesorgt zu haben, und zweifelte nicht, daß damit nun etwas Gründliches und Rechtes getan sei. Der Sohn aber hatte nun Gelegenheit, die andere Seite des Schuldenmachens kennenzulernen, welche ist die nachträgliche Bezahlung eines schon genossenen und vergangenen Stück Lebens, eine unerbittliche und kühle Ausgleichung, gleichviel ob die gelebten Tage, deren Morgen- und Abendbrot angeschrieben steht, etwas getaugt haben oder nicht. Ehe zwei Stunden verflossen, hatte Heinrich in einem Gange die zweijährige Ersparnis der Mutter nach allen Winden hin ausgetragen und behielt gerade soviel übrig, als zu dem Mitmachen jenes Künstlerfestes erforderlich war.
Ein recht vorsichtiger und gewissenhafter Mensch würde nun ohne Zweifel in Rücksicht auf die Umstände und auf die Herkunft des kostbaren Geldes sich vom Feste zurückgezogen und doppelt sparsam gelebt haben; aber derselbe hätte sich auch recht bescheiden und ärmlich angestellt, die Größe der erhaltenen mütterlichen Gelder verschwiegen und seine Gläubiger demütig und vorsichtig hingehalten, alles aus der gleichen Rücksicht, und hätte seine Vorsicht mit dem lebendigen Gefühl der Kindespflicht gerechtfertigt. Heinrich aber, da er dies nicht tat, befand sich nach dem Feste wieder wie vorher, und wenn er sich darüber nicht verwunderte oder grämte, so geschah dies nur, weil seine Gedanken und Sorgen durch jene anderweitigen Folgen der übel abgelaufenen Lustbarkeit abgelenkt wurden.
Er lebte also von neuem auf Borg, und da er diese Lebensart nun schon eingeübt hatte, auch dieselbe nach der stattgehabten Abrechnung trefflich vonstatten ging, Heinrich zugleich aber nicht mehr an der zusammenhaltenden Handarbeit saß und auch nicht mehr mit solchen Freunden umging, die den Tag über an zurückgezogener werktätiger Arbeit saßen, sondern mit allerlei studierendem, oft halbmüßigem Volke, so gewann dies neue Schuldenwesen wieder einen andern Anstrich als das frühere; je weniger er bei seinem neuen Treiben ein nahes Ziel und eine Auskunft vor sich sah, desto mehr verlor und vergaß er sein armes Muttergut und den Mutterwitz der ökonomischen Bescheidenheit und Sparsamkeit, die Kunst, sich nach der Decke zu strecken, und den Maßstab des Möglichen auch mitten in der Verwirrung. Er verlor dies Muttergut zwar nicht von Grund aus und für immer wie einen Anker, den ein Verzweifelter sinken läßt, sondern wie ein Gerät, welches für einen gewagten Auszug nicht recht paßt und welches man unwillkürlich liegenläßt, um es bei der Rückkehr wieder aufzunehmen, wie eine feine kostbare Uhr, welche man vor einer zu erwartenden Balgerei von sich legt, oder wie das ehrbare Bürgerkleid, welches man in den Schrank hängt beim Einbruch der Elemente, der Regenflut und des Schmutzwetters.
Die vermehrten Vorstellungen und Kenntnisse, das täglich neu genährte Denkvermögen, welches so lange geschlummert, erweckten von selbst eine rührige Bewegung, so daß Heinrich sich vielfach umtrieb und mit einer Menge von Leuten umging, welche den verschiedensten Studien, Richtungen und Stimmungen angehörten. Es wiederholte sich jener Vorgang aus seiner Kinderzeit, als er, indem er seine Sparbüchse verschwendete, plötzlich ein lauter und beredter Tonangeber geworden war. Auch jetzt entwickelte er unversehens eine große Beredsamkeit, ward, was er sich früher auch einmal sehnlich gewünscht hatte, ein meisterlicher Zecher, welcher die deutsche Zechweise mit so viel Phantasie und Geschicklichkeit betrieb, daß die so verbrachten Stunden und Nächte eher ein lehrreicher Gewinn, eine Art peripatetischer Weisheit schienen als ein Verlust. Das, was man lernte und sich mitteilend kehrte und wendete, geriet durch das aufgeregte Blut erst recht in Bewegung und durch die gesellschaftlichen Gegensätze, durch die hundert bald komischen, bald ernsten Konflikte in lebendigen Fluß, und das scheinbar rein Wissenschaftliche und Farblose bekam durch das gesellschaftliche und moralische Verhalten der Leute bestimmte Färbung und Anwendung oder diente diesem zu sofortiger Erklärung. Erst war die gewohnte Art herrschend gewesen, bei hervortretendem Widerspruche sich unwiderruflich auf seiner Seite zu halten, die Ehre in der Hartnäckigkeit zu suchen, mit welcher man um jeden Preis eine Meinung behaupten zu müssen glaubt, und im allgemeinen bei allen Andersdenkenden einen bösen Willen oder Unfähigkeit und Unwissenheit vorauszusetzen. Heinrich aber, welchen nun die Dinge von Grund aus zu berühren anfingen und welcher sich mit warmer Liebe um das Geheimnis ehrlicher Weltwahrheit bekümmerte, wie sie im Menschen sich birgt, ihn bewegt oder verläßt, brachte mit unbefangener und durchdringender Kraft zur anfänglichen Verwunderung der anderen die Lebensart auf, Recht- oder Unrechthaben als ganz gleichgültige Dinge zu betrachten und erst ihre Quellen als einen beachtenswerten Gegenstand aufzunehmen, in der höflichen und artigen Voraussetzung, daß es alle gut meinen und alle fähig wären, das Gute einzusehen. Dabei war er, wenn er sich ins Unrechthaben hineingeredet hatte, selbst der erste, welcher darüber nachdachte und bei kühlerm Blute sich selbst preisgab, die Sache wieder aufnahm und seinen Irrtum auch nach den eifrigsten und härtesten; Äußerungen eingestand und von neuem untersuchen half, jene falsche Höflichkeit verdrängend, welche mit dem kalten Aufsichberuhenlassen einer Sache einen um so größern heimlichen Hochmut und einen Dorn im Bewußtsein aller davonträgt. Diese Weise machte sich um so leichter geltend, als es sich bald bemerklich machte, daß nur diejenigen, welche einen wirklich bösen Willen oder eine gewisse Unfähigkeit besitzen mochten, mit jenem kalthöflichen Abbrechen sich zurückzuziehen beliebten und jeder also auch den Schein hievon vermeiden wollte. In solchen Fällen stellte es sich dann auf das liebenswürdigste heraus, daß durch diesen bloßen Schein die innerlich Widerstrebenden und Murrenden doch eine goldene Brücke fanden und unvermerkt auf die bessere Seite gezogen wurden und so einen Gewinn davontrugen, den sie früher nie gekannt in ihrem verstockten Wesen. Zugleich kam die löbliche Manier auf, alles im gleichen Flusse und mit gleicher Schwere oder Leichtigkeit zu behandeln und die anmaßliche Art zu unterdrücken, einzelne vorübergehende Entdeckungen, Einfälle und Bemerkungen feierlich zu betonen und steifschreierisch vorzutragen, als ob jeden Augenblick eine Perle gefunden wäre zu ungeheuerster Erbauung, welche Art derjenigen schlechter Skribenten gleicht, die alle Augenblicke ein Wort unterstreichen, einen neuen Absatz machen und ihre magere Schrift mit allen aufgehäuften interpunktorischen Mitteln überstreuen. Denn die gute schriftliche Rede soll so beschaffen sein, daß, wenn sie durch Zeit und Schicksale aller äußeren Unterscheidungszeichen beraubt und nur eine zusammengelaufene Schriftmasse bilden würde, sie dennoch nicht ein Jota an ihrem Inhalt und an ihrer Klarheit verlöre.
Читать дальше