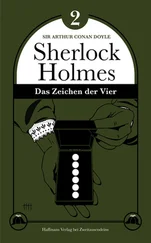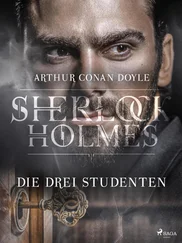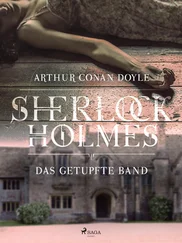Verwirrt und betäubt von dem schweren Schicksalsschlag, der ihn so unvermutet traf, stützte sich Jefferson auf sein Gewehr, sonst wäre er umgesunken. Doch rasch überwand er diesen Anfall von Schwäche, denn er war seiner ganzen Natur nach ein Mann der That. Mit bebender Hand zog er ein erst halbverkohltes Holzstück aus der Asche, blies die glimmenden Funken zur Flamme an und untersuchte mit Hilfe dieser Leuchte den Lagerplatz. Der Boden war nach allen Seiten hin von Pferdehufen zerstampft, ein Beweis, daß die Flüchtlinge durch eine große Schar Berittener eingeholt worden, welche dann, wie die vorhandenen Spuren vermuten ließen, die Richtung nach der Salzseestadt eingeschlagen hatten. Waren Vater und Tochter in ihre Hände gefallen und beide von ihnen mit fortgeschleppt worden? – Jefferson Hope mochte dies zuerst geglaubt haben, allein plötzlich fuhr er zusammen, und das Blut erstarrte ihm in den Adern. Etwas abseits von dem Lagerplatz sah er einen frisch aufgeworfenen Haufen rötlicher Erde, der vorher sicherlich nicht dagewesen war. Hatte man dort ein Grab gegraben? – Der junge Jäger trat naher hinzu – im Boden steckte ein Stab, an dem ein Blatt Papier befestigt war. Es trug eine kurze, aber bedeutsame Inschrift:
»John Ferrier aus der Salzseestadt,
gestorben den 4ten August 1860.«
Der wackere, alte Mann, den er vor wenigen Stunden erst in der Fülle der Kraft verlassen, war also tot und dies seine ganze Grabschrift. Jefferson sah sich mit wilden Blicken nach einem zweiten Hügel um, aber ein solcher war nicht zu entdecken. Die Unmenschen mußten Lucy mit sich geführt haben, um sie dem Sohn des Aeltesten zu übergeben, damit sie das ihr bestimmte Geschick erfülle und ihm als Frau in seinen Harem folge. Als Jefferson erkannte, wie völlig machtlos er sei, dies Schicksal von ihr abzuwenden, da schien ihm im ersten Augenblick der alte Ferrier beneidenswert, der da unten den stillen Schlaf des Todes schlief. Doch nicht lange überließ er sich seiner dumpfen Verzweiflung. War ihm nichts anderes geblieben, so konnte er wenigstens sein Leben der Rache weihen.
Während er starren Auges dastand und in die Asche blickte, fühlte er, daß es für seinen Schmerz keine Linderung gab, bevor er nicht mit eigener Hand blutige Wiedervergeltung an seinen Feinden geübt hätte.
Neben unermüdlicher Geduld und Ausdauer lag in Jeffersons Charakter eine nicht zu bezähmende Rachsucht, die er vielleicht von den Indianern gelernt hatte, unter denen er solange gelebt. Sein starker Wille, seine rastlose Thatkraft sollten jetzt nur noch das eine Ziel verfolgen, das war sein fester Entschluß. Mit bleicher, ingrimmiger Miene kehrte er nach der Stelle zurück, wo seine Jagdbeute noch am Boden lag, darauf blies er das Feuer an und bereitete sich Speise für die nächsten Tage. Dann brach er auf, ohne seiner Ermüdung zu achten, um der Spur der Würgengel durch das Gebirge zu folgen.
Fünf Tage lang pilgerte er mit wunden Füßen durch die Schluchten und Hohlwege zurück, welche er vor kurzem hinaufgeritten war. Bei Einbruch der Nacht warf er sich unter einem Felsvorsprung nieder, um ein paar Stunden zu ruhen, und sobald der Morgen graute, begann er seine Wanderung von neuem. Als er am sechsten Tage erschöpft und abgemattet die Adlerschlucht erreichte, von wo aus ihre unheilvolle Flucht den Anfang genommen, sah er die ›Stadt der Heiligen‹ weit ausgebreitet zu seinen Füßen liegen. In ohnmächtigem Zorn schüttelte er drohend die geballte Faust gegen den Wohnplatz der Uebelthäter. Aber halt – was hatte das zu bedeuten? – In den Hauptstraßen sah er Fahnen von den Dächern wehen und festlichen Schmuck an den Häusern. Während er noch darüber nachsann, schallte der Hufschlag eines Pferdes und ein Reiter kam herangetrabt. Jefferson kannte den Mann, es war der Mormone Cowper, dem er früher manchen Dienst erwiesen hatte; von ihm durfte er hoffen, Nachricht über Lucys Schicksal zu erhalten.
Der Mormone sah Jefferson zuerst mit ungläubigen Blicken an, als ihm dieser in den Weg trat und seinen Namen nannte. Wer hatte auch in dem verwilderten und zerzausten Wanderer mit den unheimlich rollenden Augen und der bleichen Miene den früher so schmucken jungen Jäger erkennen sollen? – Sobald Cowper jedoch wußte, wen er vor sich hatte, erschrak er heftig.
»Seid Ihr rasend, daß Ihr Euch hierher wagt?« rief er. »Wenn man mich hier im Gespräch mit Euch sieht, ist mein eigenes Leben verwirkt. Wißt Ihr nicht, daß die ›heiligen Vier‹ einen Haftbefehl gegen Euch erlassen haben, weil Ihr den Ferriers zur Flucht behilflich gewesen seid?«
»Ich fürchte weder die Schurken noch ihren Haftbefehl,« rief Jefferson entrüstet. »Cowper,« fuhr er dann, seine Erregung bezwingend, fort, »wir sind immer Freunde gewesen – bei allem, was Euch teuer ist, beschwöre ich Euch, mir eine Frage zu beantworten. Um Gottes willen, verweigert mir die Antwort nicht.«
»Was wünscht Ihr zu wissen?« fragte der Mormone, sich ängstlich umblickend; »redet schnell, hier hat alles Augen und Ohren, auch die Felsen und Bäume.«
»Was ist aus Lucy Ferrier geworden?«
»Man hat sie gestern dem jungen Drebber zur Frau gegeben. – Faßt Euch, Mann, faßt Euch – Ihr werdet ja bleich wie der Tod.«
Jefferson war auf den nächsten Felsblock niedergesunken, seine Lippen bebten. »Drebbers Frau, sagt Ihr?« stammelte er mit brechender Stimme.
»Ja, seit gestern – deshalb seht Ihr auch die Stadt noch im Fahnenschmuck. Drebber und Stangerson, die jüngeren, stritten sich um ihren Besitz. Bei der Verfolgung, an der sich beide beteiligt hatten, war ihr Vater von Stangersons Hand gefallen, was diesem ein größeres Vorrecht zu geben schien. Als jedoch die Frage vor die Ratsversammlung gebracht wurde, war Drebbers Anhang stärker und der Prophet entschied zu seinen Gunsten. Es wird sie aber keiner lange sein eigen nennen, sie sieht geisterbleich aus und der Tod stand ihr schon gestern im Gesicht geschrieben. – Wollt Ihr jetzt fort?«
»Ja, ich gehe,« sagte Jefferson, sich mühsam erhebend; sein Antlitz war bleich und starr, wie aus Marmor gemeißelt, nur in seinen Augen glühte ein wildes Feuer.
»Wo wollt Ihr hin?«
»Fragt mich nicht,« erwiderte er und hing sich die Flinte über die Schulter. Dann schritt er die Schlucht hinab und vergrub sich tief in den Bergen, wo nur Bären und Wölfe hausten; aber keines der reißenden Tiere war grimmiger und blutdürstiger als er.
Was der Mormone vorausgesagt hatte, ging nur zu bald in Erfüllung. War es der Schmerz über den plötzlichen Tod ihres Vaters, was der armen Lucy am Lebensmark zehrte, oder der Abscheu vor der verhaßten Ehe, zu der man sie gezwungen – sie siechte von Tag zu Tag dahin und starb noch ehe ein Monat um war. Der rohe Mensch, welcher sie nur geheiratet hatte, um Ferriers reichen Besitz in die Hände zu bekommen, trug wenig Kummer zur Schau über seinen Verlust. Aber seine andern Frauen trauerten um die Tote und hielten in der Nacht vor dem Begräbnis bei ihr die Leichenwache, nach Sitte der Mormonen. Sie saßen noch um die Bahre, als beim ersten Morgengrauen die Thür plötzlich aufging und sie mit Staunen und Entsetzen einen wilddreinschauenden, wettergebräunten Mann in zerfetzter Kleidung eintreten sahen. Ohne auch nur einen Blick auf die geängstigten Frauen zu werfen, schritt er nach dem Totenschrein, in dem Lucys entseelte Hülle ruhte. Er beugte sich über sie und berührte ihre kalte Stirn ehrfurchtsvoll mit den Lippen, dann ergriff er sie bei der Hand und zog ihr den Trauring vom Finger. »Den soll man ihr nicht mit ins Grab geben,« murmelte er dumpf. Bevor noch jemand die rätselhafte Erscheinung anhalten konnte, verschwand sie wieder, wie sie gekommen war. Das alles geschah so rasch, und der Vorgang schien so seltsam, daß man dem Bericht der Wächterinnen schwerlich Glauben geschenkt hätte, ohne die Thatsache, daß der goldene Reif wirklich vom Finger der Toten verschwunden war.
Читать дальше