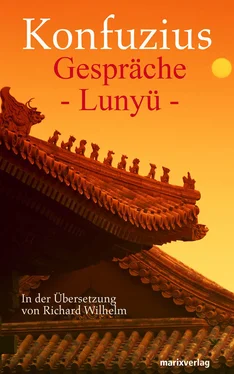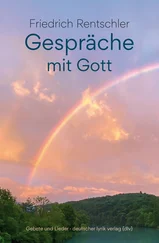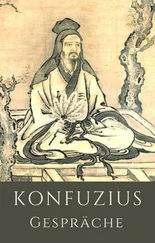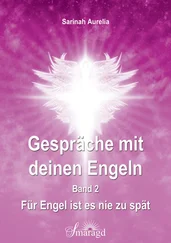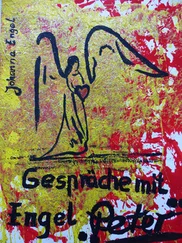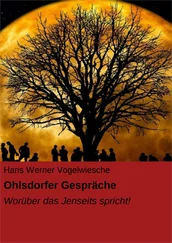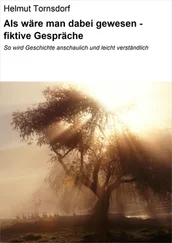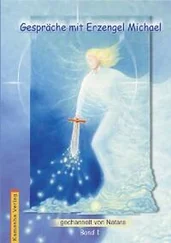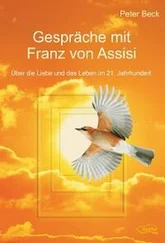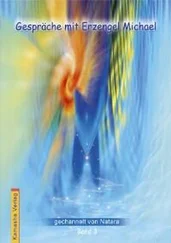Trotzdem diese Literatur zum Teil recht bedeutend gelitten hatte, sind uns dennoch in ihr die Richtlinien dessen aufbewahrt, was Kung in der Vergangenheit als Grundlage seiner Arbeit anerkannte. Die Heroen der Vergangenheit, die Schöpfer der chinesischen Kultur, die Kung vor Augen stehen, sind sieben an der Zahl: Gott Yau (Erhaben), Gott Schun (Gütig), der Große Yü, der Vollkommene Tang, ferner die drei Begründer der Dschoudynastie: König Wen und dessen zwei Söhne König Wu und der Fürst von Dschou. Wohl geht Kung nicht in jene grauen Urzeiten zurück, die in späteren Geschichtswerken immer ausführlicher behandelt werden; aber das große Dreigestirn der Kulturschöpfung Yau, Schun und Yü 1, deren Zeit von 2300–2200 v. Chr. angesetzt zu werden pflegt, ist doch wohl auch kaum historisch. Schon daß Yau und Schun den Titel »Gott« tragen – denn die gewöhnliche Übersetzung mit »Kaiser« ist schon durch die Stellung des Wortes vor dem Namen ausgeschlossen – macht bedenklich. Aber auch die Zustände, wie sie unter diesen Herrschern sind und an das goldene Zeitalter anderer Mythen erinnern, finden im Verlauf der Geschichte keine Fortsetzung. Was von Yau, Schun und Yü erzählt wird, kommt aber dennoch in Betracht als Ideal, das Kung von der Vergangenheit besaß und an das er anknüpfen konnte. Die Ideale, die jene Heroen darstellen, sind die Grundlagen einer geordneten Regierung eines ackerbautreibenden Volkes. Was von Yau erzählt wird, bewegt sich durchaus in dieser Richtung. Ein ackerbautreibendes Volk braucht eine geordnete Zeitrechnung, damit die Beschäftigungen der Menschen in Einklang kommen mit dem Naturlauf, gut geordnete Wasserläufe, um Dürre und Überschwemmungen fernzuhalten, und endlich eine Regierung, die sich möglichst wenig durch Eingriffe in das persönliche Leben und Treiben des Volkes bemerkbar macht. So wird denn von Yau außer seiner persönlichen Tugend berichtet, daß er die Himmelserscheinungen in einem Kalender zur Darstellung brachte und in dem von seiner Familie verfolgten, aus ganz einfachen Verhältnissen hervorgegangenen Schun sich einen Gehilfen und Nachfolger herangezogen hat. Doch gelang es ihm noch nicht, der Überschwemmungen Herr zu werden. Dieses Werk vollendete Schun mit Hilfe des Großen Yü, der den sämtlichen Flüssen Nordchinas ihren Lauf anwies. Während Yau mehr mit den Himmelserscheinungen in Zusammenhang steht, ist Schun, der in seiner Jugend Landmann war, mehr mit den irdischen Verhältnissen verknüpft: Ackerbau, Töpferei, Fischfang und Jagd sind Tätigkeiten, die ihm die Legende zuschreibt. Und ähnlich wie Yau, unter Hintansetzung seines unwürdigen Sohns, sein Reich an Schun abgibt, – nachdem, wie taoistische Legenden nicht ohne Bosheit berichten, eine ganze Anzahl taoistischer Heiliger den Thron ausgeschlagen hatten – so wählt auch Schun als seinen Nachfolger den würdigsten seiner Beamten, den Bändiger der Gewässer: Yü. An Yü den Großen schließt sich die erste durch Erbfolge begründete Dynastie, die Hiadynastie an. Im Verlauf der Dynastie folgt auf das goldene Zeitalter jener Herrscher allmählicher Niedergang, bis mit dem letzten Herrscher aus dem Hause Hia, dem ausschweifenden und tyrannischen Giä, die Unmoral einen Gipfel erreicht, der »die Strafe des Himmels« herausfordert. Der Tyrann wird gewaltsam abgesetzt, und der »Vollkommene«, Tang, gründet die zweite Dynastie, die sogenannte Schangdynastie, deren Bezeichnung später in Yin umgewandelt wird. Die Gestalt des Tang ist dadurch im chinesischen System bemerkenswert, als wir in ihm den Heiligen als Empörer haben. Nachdem der Tyrann die Berufung des Himmels verscherzt hatte, geht diese auf den würdigeren Gründer einer neuen Dynastie über. An der Zuneigung des Volkes erkennt man, daß er wirklich einen höheren Beruf hat; denn des Volkes Stimme ist Gottes Stimme. Im übrigen übernimmt die neue Dynastie die Einrichtungen der alten unter zeitgemäßen Abänderungen. Auch das bleibt Grundsatz für die Jahrtausende in China: das große Erbe der Vergangenheit, die Summe der Kultur und Autorität kann wohl von einem Haus an das andere übergehen, aber die Tradition bleibt gewahrt, ähnlich wie auf anderem Gebiet im Papsttum. Von dieser theoretischen Erwägung abgesehen zeigt sich die zweite Dynastie ziemlich genau als Dublette der ersten; namentlich der Tyrann, der den Zorn des Himmels herabbeschwört, trägt unverkennbare Familienähnlichkeit mit dem Tyrannen Giä. Er heißt Schou Sin, und seine ausschweifende Gemahlin heißt Da Gi; im übrigen aber ist sein Lebenswandel nur eine Wiederholung der Ausschweifungen und Grausamkeiten des letzten Herrschers der Hiadynastie. Es fehlen zurzeit noch die Mittel, um festzustellen, wie das historische Verhältnis ist, ob es sich um zufällige Übereinstimmung handelt, oder ob der Thronsturz des Giä einfach eine in die Vergangenheit zurückprojizierte Analogie der Ereignisse zur Zeit des Schou Sin ist.
Soweit uns die vorhandenen Urkunden gestatten, uns ein Bild von den Zuständen der alten Zeit zu machen – und außer den konfuzianischen Quellen kommen hier auch taoistische in Betracht, die in mancher Hinsicht den alten chinesischen Zuständen noch näher treten als der eine »Reformation« darstellende Konfuzianismus – scheinen die Verhältnisse recht einfach gewesen zu sein. Selbst der Herrscher, dessen Macht oft übrigens mehr nominell gewesen zu sein scheint, lebte noch keineswegs luxuriös. Manche Schilderungen aus der alten Zeit, besonders in Beziehung auf Yü, geben recht primitive Bilder. Die Wirtschaftsform war agrarisch. Bedeutender als kriegerische Eroberung war friedliche Durchdringung weiter, noch unkultivierter Gebiete. Infolge davon ist die Gesellschaftsstruktur wesentlich von der westlichen verschieden. Im Okzident baute sich die Volksgemeinschaft fast durchweg auf dem Grund der kriegerischen Organisation der wehrfähigen Mannschaft auf. Darum war der Einzelne aus dem Kreis der Krieger Träger selbständigen Rechts innerhalb der Sippen. Der einzelne freie Mann bildete die Zelle der Gesellschaft, die sich je nach den Verhältnissen zur Demokratie oder Militärdespotie weiter entwickeln konnte. Auf alle Fälle waren damit die Grundlagen für eine Entwicklung des Individuums und somit auch für individuelle Religion und individuelle Moral gegeben. Ganz anders in China. Hier steht nicht kriegerische Eroberung, sondern friedliche Durchdringung am Anfang. Schon frühe hören wir von der Einteilung des Landes in Felder, die den einzelnen Familien zur Bebauung übergeben wurden. Die Feldbebauung setzt aber in der Familie ganz von selbst eine kollektivistische Wirtschaftsform voraus. So ergibt sich als Grundzelle des chinesischen gesellschaftlichen Organismus nicht das Individuum, sondern die kommunistische Familie. Es verdient hier hervorgehoben zu werden, daß sich Spuren eines Zustandes der Mutterfolge noch nachweisen lassen, doch scheint die Familie unter der Herrschaft des Vaters schon ziemlich weit zurückzugehen, wenn auch in der fast religiösen Betonung der väterlichen Autorität noch der Einfluß der Umwandlung der Sippe in die Familie durchklingt. Da aber zur Sicherung und Regelung des Lebens gemeinsame Unternehmungen unter einheitlicher Leitung, wie z. B. die schon erwähnte Flußregulation, notwendig waren, so bildet sich das Familienpatriarchat zum gesellschaftlichen Patriarchat mit dem Fürsten an der Spitze weiter. Wir finden die ethischen, religiösen und naturwissenschaftlichen Verhältnisse des vorkonfuzianischen China durchaus in Übereinstimmung mit den theoretischen Folgerungen, die sich aus diesen Zuständen ziehen lassen. Während in der Ethik des Westens die kriegerische Tugend des Muts und die damit zusammenhängenden Tugenden des Forschungstriebes und Wahrheitssinnes die Keimzelle für die ethische Entwicklung bilden, steht in China die gewißenhafte Einordnung in den Familienorganismus und durch ihn in den Gesellschaftsorganismus obenan, eben weil das die Tugend war, die innerhalb der gegebenen sozialen Verhältnisse am nötigsten und wertvollsten sich erwies. Von hier aus wird uns die Rolle, welche in China die Pietät spielt, ohne weiteres klar, und ebenso klar ist, wie ungerecht eine Beurteilung der chinesischen Kultur sein muß, die, wie das immer wieder geschieht, als Maßstab die auf ganz anderem Boden erwachsenen Prämissen unserer Kultur anlegt.
Читать дальше