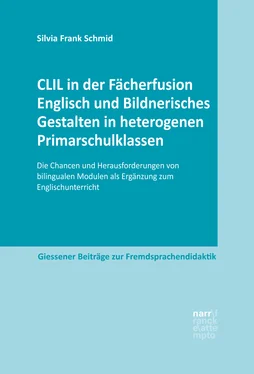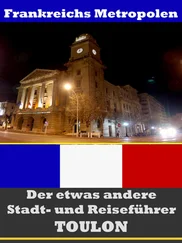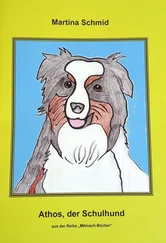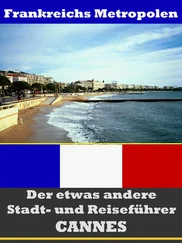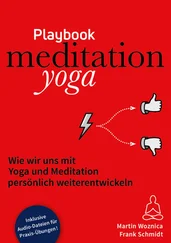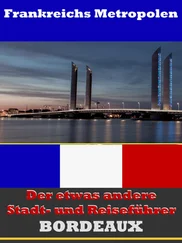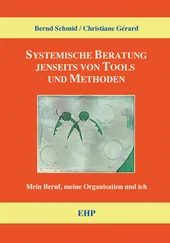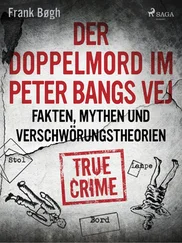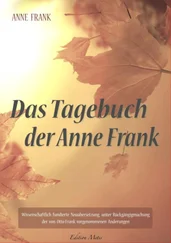Während die originale Bloom’sche Taxonomie beabsichtigte, vermehrt ‘higher-order’ Lernziele im Unterricht zu berücksichtigen, macht die revidierte Taxonomie darauf Aufmerksam, im Lernprozess metakognitives Wissen zu fördern (Anderson et al. 2001, S. 44). Damit ist gemeint, dass die Lernenden durch bewusstes Nachdenken über das eigene Lernen und den kooperativen Austausch in Gruppen metakognitives Wissen aufbauen. Dies hilft ihnen, ihr individuelles Lernen als auch die kooperative Zusammenarbeit zu steuern und zu optimieren (Baer 2016, S. 54; D-EDK 2014 Bildungsziele). Die Metakognition tanzt streng genommen etwas aus der Reihe, da sie sich nicht direkt – wie die anderen drei Wissensarten – auf fachliche Inhalte bezieht. Trotzdem passt die Metakognition in den Aufbau der Taxonomie und beschreibt auf der höchsten Abstraktionsstufe die Fähigkeit das eigene Denken, Lernen und die eingesetzten Strategien zu reflektieren. Reusser (2014b, S. 334) spricht in diesem Zusammenhang auch von der Wichtigkeit das ‘Könnensbewusstsein’ oder ‘Kompetenzerleben’ zu stärken, das durch die erfolgreiche Bearbeitung eines Aufgabensets sichtbar wird. Die Schwierigkeit besteht darin, die metakognitive Kompetenz zu prüfen, da diese nicht wie alle anderen Wissensarten in einer klaren, eindeutigen und korrekten Antwort resultiert. Vielmehr geht es bei dieser Wissensart darum das Nachdenken über das eigene Lernen zu stärken, den Austausch über das Lernen und die angewendeten Strategien zu fördern und somit insgesamt die Bewusstheit über das eigene metakognitive Wissen anzuregen (Anderson et al. 2001, S. 61–62). Dies lässt sich mit gezielten und regelmässigen Reflexionsmomenten umsetzen. Die dadurch geförderte Eigenständigkeit und Selbstreflexion sind zudem zwei grundlegende überfachliche Kompetenzen des 21. Jahrhunderts (vgl. Dede 2010, S. 51ff).
Nachdem erläutert wurde, wie das hier thematisierte Aufgabenmerkmal der ‘kognitiven Aktivierung’ definiert wird, wird nachfolgend erklärt, was dieses komplexe Merkmal für die Entwicklung der Lernaufgaben für den CLIL-Unterricht impliziert. Um insgesamt die Qualität der kognitiven Aktivierung der geplanten Lernaufgaben im CLIL-Unterricht zu analysieren, muss bereits auf Planungsebene sichergestellt werden, dass verschiedene Typen von Lernaufgaben in Anlehnung an das LUKAS-Modell im Verlauf des CLIL-Moduls berücksichtigt werden. Sie fördern in ihrer Gesamtheit mit den in den verschiedenen Aufgabentypen naturgemäss unterschiedlich vorkommenden kognitiven Anspruchsniveau den Kompetenzerwerb (vgl. Abbildung 11). Wenn es somit gelingt, ein Aufgabenset bestehend aus diesen verschiedenen Aufgabentypen zu entwickeln, kann davon ausgegangen werden, dass die Lernaufgaben als Aufgabenset insgesamt kognitiv aktivierend sind.
Des Weiteren und daran anknüpfend scheint es für die Planung des Aufgabensets zweckdienlich zu sein, anstatt den sechs Abstufungen von kognitiven Prozessen sich an der vereinfachten Einteilung in zwei Stufen gemäss LOTS und HOTS zu orientieren. Grund dafür ist die Tatsache, dass im CLIL-Unterricht zwei Systeme von unterschiedlichen fachspezifischen Lernprozessen aufeinandertreffen, die in sich hinsichtlich kognitiver Aktivierung inkongruent sind und eine exakte Einteilung in diese sechs kognitiven Stufen verunmöglichen. Die Beibehaltung der vier Wissensarten scheint jedoch sinnvoll zu sein, um innerhalb der LOTS und HOTS besser zu differenzieren, welche Lernabsichten mit den Aufgaben gestellt werden. Die breit angelegten LOTS und HOTS lassen sich zudem mit allen vier Wissensarten kombinieren. Zum Beispiel können Schüler*innen im CLIL-Modul eine vorgezeigte Zeichnungstechnik nachahmen ( LOTS in Kombination mit Procedural Knowledge ) oder sie könnten eine passende Zeichnungstechnik für eine bestimmte Bildlösung selber entwickeln und anschliessend erläutern, wieso sie diese gewählt haben (HOTS in Kombination mit Procedural und Metacognitive Knoweldege) . Ziel ist es somit, innerhalb des CLIL-Moduls möglichst vielfältige, somit auch komplexe, Lernaufgaben anbieten zu können und diese so zu formulieren, dass sie von den Expert*innen als auch Lehrpersonen eindeutig klassifizierbar sind und bei den Lernenden die gewünschten kognitiven Prozesse in Form von beobachtbaren Handlungen auslösen.
Schliesslich passiert lernen, wie bereits angetönt, in der Zone der proximalen Entwicklung. Somit besteht der Anspruch insgesamt darin Lernaufgaben bereitzustellen, die die Lernenden fordern, ohne sie zu überfordern. Dies ist gerade im CLIL-Unterricht äusserst anspruchsvoll, weil nicht nur die fremdsprachlichen Kenntnisse, sondern auch die sachfachlichen Voraussetzungen der Lernenden stark variieren. Es kann auf zwei Arten auf die vorherrschende Heterogenität im CLIL-Unterricht reagiert werden. Eine Variante ist, dass jede einzelne Lernaufgabe hinsichtlich ihres kognitiven Anspruchsniveaus adaptiert wird. Die Abbildung 11 zeigt anschaulich auf, wie die Anforderungen an die Lernaufgaben in zweidimensionaler Hinsicht erschwert oder erleichtert werden können. Das Variieren mit diesen Dimensionen stellt somit eine Möglichkeit auf, wie auf den Anspruch nach flexiblen Lernaufgaben für die heterogenen Lernenden und ihre unterschiedlichen Zonen der nächsten Entwicklung reagiert werden kann (vgl. Keller & Bender 2012, S. 11). Was sich simpel anhört, ist in der Umsetzung äusserst anspruchsvoll: Nicht nur weil die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Stufen, somit auch zwischen der Abgrenzung von LOTS und HOTS , nicht trennscharf sind, sondern auch weil zwischen dem theoretischen kognitiven Potential einer Aufgabe und deren tatsächlichen Realisierung im Lernprozess eine grosse Differenz liegt (Maier et al. 2010, S. 28, 31). Das bedeutet konkret, dass die geplanten Lernaufgaben von unterschiedlichen Lernenden naturgemäss sowieso verschieden bearbeitet werden, sie somit wahrscheinlich nicht bei allen Lernenden die gleichen kognitiven Prozesse auslösen und somit dann auch in ihrer Klassifikation bezüglich ihres kognitiven Potentials von der ursprünglich geplanten Lernaufgabe abweichen. Gleichzeitig ist es jedoch nicht die Absicht, dass lernschwächere Schüler*innen nur Lernaufgaben gemäss den LOTS bearbeiten, sondern sie sollen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch an solche mit höherem kognitiven Anforderungsniveau wagen. Deshalb, als zweite Variante um die Heterogenität zu berücksichtigen, ist es wahrscheinlich zielführender, anstelle von verschiedenen adaptierten Lernaufgaben, mehrheitlich offene Lernaufgaben und flexible Unterstützungsangebote im Unterricht anzubieten. Diese beiden Aspekte werden bei mit den nachfolgenden Qualitätsmerkmalen ‘Offenheit’ und ‘Differenzierung’ erläutert (siehe Kapitel 3.5.4 und Kapitel 3.5.5).
Zusammengefasst heisst das nun, dass die Lernaufgaben im Hinblick auf ihr kognitives Aktivierungspotential vor allem dadurch evaluiert werden können, ob sie einerseits als Teil eines Aufgabensets aus unterschiedlichen Aufgabentypen bestehen und anderseits, ob diese Aufgabentypen das Potential ausweisen, um die ihnen zugeschriebenen Wissens- und Denkprozesse auszulösen.
An dieser Stelle noch eine weiterführende Anmerkung: Wie einleitend erwähnt, ist das Qualitätsmerkmal der ‘kognitiven Aktivierung’ im Fachbereich BG nicht prioritär. Dies hat sich auch im Gespräch mit den Expert*innen aus dem Fachbereich BG gezeigt. Neben der Kognition braucht es gemäss Expertenmeinungen auch emotionale und sinnliche Aktivierung, um bildnerische Lernprozesse anzuregen. Auch wenn diese in der Theorie oft nicht explizit erwähnt werden, ist die emotionale, sinnliche Aktivierung für gestalterische Lernprozesse unumgänglich (Morawietz & Niederberger 2018, S. 278). Der Einbezug von verschiedenen Sinnen ist zwar stark von der der Fachdidaktik BG geprägt, doch deckt sich deren Wichtigkeit auch mit den fachdidaktischen Ansätzen im Lehren von Fremdsprachen mit Primarschulkindern. Auch hier spricht man von einem holistischen, multisensorischen Ansatz, um Lernen vielfältig verknüpft und mehrperspektivisch anzubieten (Cameron 2001, S. 24–25). Im Verlauf des CLIL-Moduls sollen demnach Lernende mit herausfordernden Lernaufgaben kognitiv als auch sinnlich zum Lernen angeregt werden. Dies mit dem Ziel, die motivationalen als auch volitionalen Bereitschaften eines jeden Kindes sich auf den Lerngegenstand einzulassen, bestmöglich zu entfalten (vgl. Weinert 2014b, S. 27–28).
Читать дальше