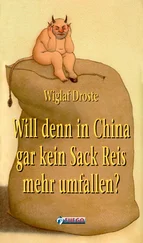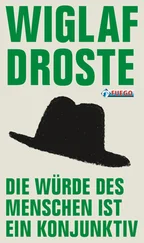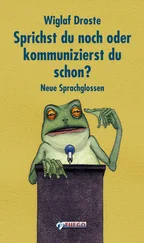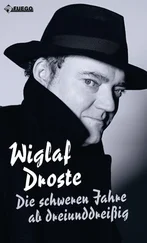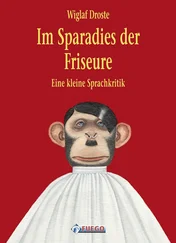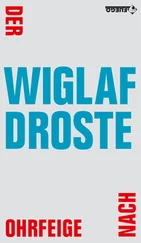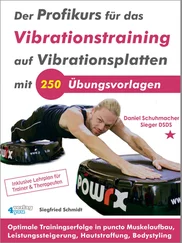Geschrieben hat den Nullsatz der Chefredakteur von fit for fun. Der Mann heißt Willi Loderhose, und man ahnt, was er wegen dieses Nachnamens hat durchmachen müssen seit seiner Pubertät. Möglicherweise haben die erlittenen Verspottungen zu einer Erosion seines Charakters geführt – die es Willi Loderhose erst ermöglichten, Chefredakteur von so etwas wie fit for fun zu werden. Das ist Spekulation; gesichert dagegen ist, dass es Willi Loderhose gelingt, den Einstieg per Krise anschließend zu erweitern und in ihr, nicht minder konfektioniert, »auch Positives zu sehen«. Denn Krise, schreibt Loderhose, »bedeutet auch ›sich trennen‹« – woraus der Autor folgert: »Trennen Sie sich jetzt von schlechten Gewohnheiten! Trennen Sie sich von ein paar Kilos Körpergewicht.«
Auf einem Krisenherd kann eben jeder seine eigene Suppe kochen – auch Willi Loderhose, mitsamt fit for fun. Zwar gilt gemeinhin das Gebot, Namenswitze gütig zu unterlassen. Im Kasus Loderhose bringe ich den Verzicht auf einen Schüttelreim allerdings nicht über mich.
Krise in der Loderhose?
Kann sein, da ist ein Hoden lose.
Das Wort Schweinskopfsülze hat unbestreitbar einen heftigen, martialischen Klang. Dabei ist Sülze, wenn sie von einem guten Metzger aus guten Materialien hergestellt wird, ein wohlschmeckendes Lebensmittel. Wie konnte geschehen, dass Sülze seit langem ein Synonym für inhaltsleeres Gerede, für überflüssigen, nichtigen Verbalschwall geworden ist? Soviel Gesülze wird von Menschen mit nimmermüden Mundwerkzeugen produziert, dass bei dem Wort ›Kaisersülze‹ kaum jemand mehr an die so bezeichnete kulinarische Köstlichkeit denkt, sondern, im Gegenteil, an den selbstgefälligen, medial begeistert aufgesogenen wie überhaupt erst hergestellten Brumm- und Bummseich, den der in denselben Medien »Kaiser« genannte Franz Beckenbauer regelmäßig wegplätschert.
Beckenbauer ist allerdings überhaupt nicht der einzige, dem die Mutation der Sülze von einer guten Mahlzeit zum unerträglichen Geseire anzulasten ist. Am Niedergang der Sülze sind viele beteiligt, die öffentlich auf dem Glatteis der freien Rede herumrutschen. Ganz weit vorn sind Politiker und Verlautbarungsjournalisten, die immerzu »auf gutem Wege« sind und für die alles »auf einem guten Weg« ist – der zuvor selbstverständlich »frei gemacht« wurde. Das klingt ein bisschen nach Arztbesuch – »Guten Tag, Herr Weg, machen Sie sich doch bitte gleich frei« –, ist aber noch trüberen Ursprungs. »Wir machen den Weg frei« ist eine alte Reklameparole der Volks- und Raiffeisenbanken, die ihre Kundschaft unter Zuhilfenahme von Bausparverträgen zu fesseln und zu knebeln gedenken. Die Phrase hat ihren Weg in die Politik und in den Journalismus gemacht; man könnte auch zum ixypsilonsten Mal konstatieren, dass Politik und Journalismus sich eben längst in den Niederungen der Werbung eingebunkert haben.
Wer »Wege frei macht« und »auf gutem Wege ist«, der betreibt Politik mit derselben Vollautomatik auch »auf Augenhöhe«. Die »Augenhöhe« wurde nicht nur vom Alfred-E.-Neumann-Double Horst Köhler beständig »angemahnt«, sondern wird auch vom Schauspielerdarsteller Till Schweiger für sich reklamiert: »Mit Tarantino rede ich auf Augenhöhe, mit Brad sowieso…«, prahlte der in Quentin Tarantinos Film »Inglourious Basterds« so wohltuend und überzeugend textarm inszenierte Schweiger, der mit dem angekumpelten »Brad« irrtümlicherweise Brad Pitt meinte, nicht aber das weit bedauernswertere Brett vor seinem eigenen Kopf – das mit Till Schweiger ja tatsächlich »auf Augenhöhe« leben muss, und das schon und für immer.
Voll »auf Augenhöhe« befindet sich auch die Musikzeitschrift spex – und zwar mit dem Nudelhersteller De Cecco, dem sie ihr Impressum als Werbefläche vermietet. spex-Chefredakteur Max Dax weiß, was Feuilleton bedeutet: die branchenübliche Hurerei als Husarenstück verkaufen. Das hört sich so an: »Wir wollen einen Diskurs darüber anregen, wie wahnsinnig hart es ist, Qualität sowie innere und äußere Unabhängigkeit im Journalismus zu garantieren.« Von einem »Diskurs« ist bevorzugt dann die Rede, wenn aus Muffensausen vor dem wirtschaftlichen Bankrott der geistige vorauseilend vollzogen wird. Das Ergebnis des spex-De Cecco-Ex-und-hopp-Diskurses steht so fest wie die Max-Dax-Definition von »innerer und äußerer Unabhängigkeit im Journalismus«:
Ein neues Kunststück kann der Pudel.
Er besingt jetzt auch die Nudel.
Auf diesen Hund hat kein Metzger die Sülze je gebracht. Das schafft die deutsche Medienöffentlichkeit ganz allein.
»Denke«, »Kenne«, »Schreibe«, »Tanke«, »Raste«: Optimistische Philologen könnten wohl meinen, bei diesen viel gebrauchten Wörtern handele es sich um den von ihnen bevorzugten Umgangston, den Imperativ – oder aber um die jeweils dritte Person Singular Konjunktiv von »denken«, »kennen«, »schreiben«, »tanken« und »rasten«. Die Worte beschrieben also in indirekter Rede, dass jemand denkt, etwas kennt oder schreibt, dass er oder sie tankt oder rastet. Aber erstens gibt es keine optimistischen Philologen, sondern nur zermürbte und kulturpessimistische, und zweitens handelt es sich nicht um Verbformen, sondern um moderne Substantive.
Mangelt es jemandem an einer zündenden Idee, dann hat er einfach nicht »die richtige Denke«. Verfügt er nicht über ausreichend Wissen, fehlt ihm »die nötige Kenne«. Manchem Schriftsteller wird »eine gute Schreibe« attestiert; der Leiter des Göttinger Literaturherbstes, Christoph Reisner, sprach sogar schon von »geilen Briten«, die »einen heißen Reifen schreiben«, weshalb er sie »nach vorne bomben« wolle. Das passt dann schon eher an die »Tanke«, den Treffpunkt von zum Komasuff entschlossenen jungen Menschen, die das Wort »Tankstelle« nicht mehr vollständig auslallen können, sondern es gerade noch zur »Tanke« schaffen, oder, falls sie motorisiert sind, zur »Raste«, der Autobahnraststätte.
Das »Denken«, das »Kennen« und das »Schreiben« sind sächlich abstrakt – in der Umgangssprache werden sie weiblich konkret: die »Denke«, die »Kenne«, die »Schreibe«. Hat, wer schnell laufen kann, analog »eine gute Renne«? Und wer treffsicher schießt, »die richtige Knalle«?
»Tanke« und »Raste« allerdings sind keine Verweiblichungen, sondern Abkürzungen – Ausdrucksformen also, die einerseits die Sprache schneller machen und andererseits die Souveränität des Sprechers unter Beweis stellen sollen. Wer zugunsten einer Initiative Transparente malt und Flugblätter schreibt, der fertigt in seiner eigenen Sprache – beziehungsweise seiner eigenen »Spreche« – »Transpas« und »Flugis« für die »Ini« an. Das klingt niedlich, cool, locker, flockig und fluffig, es scheint die Zugehörigkeit zur richtigen Gruppe zu beweisen – und es suggeriert, da beherrsche einer den Gegenstand, mit dem er es zu tun hat.
Die DDR-Wortschöpfungen »Plaste« und »Elaste« dagegen dienten ursprünglich der gesellschaftlichen Unterscheidung; »Plastik« und »Elastik« waren englischstämmig, kapitalistisch und böse, Plaste und Elaste deutsch, sozialistisch und gut. Wer heute »Plaste« oder gleich »Plaste und Elaste aus Zschkopau« sagt, betont damit entweder seine DDR-Herkunft – oder demonstriert, durch ironischen Gebrauch, dass er zur DDR auf Abstand hielt und immer noch hält, obwohl es sie längst nicht mehr gibt.
Die Bundesrepublik ihrerseits hatte vieles, das es in der DDR nicht gab – zum Beispiel Religionsunterricht, der bei Schülern selbstverständlich verkürzt »Reli« hieß, manchmal aber auch »Region«. Diese saloppe sprachliche Entheiligung setzt sich fort, wenn im Andenkenladen christliche Devotionalien als »Devos« angeboten werden, was stark nach dem englischen Plural »Devils« klingt, nach Teufeln. Und die Dämonen des Kommerzes und des schlechten Geschmacks stecken ja tatsächlich in jeder Devotionalie, in jedem Kitschbild vom Pontifex, in jedem Kruzifix aus Plastik oder Plaste, das man sogar an der Tanke kaufen kann oder an der Raste.
Читать дальше