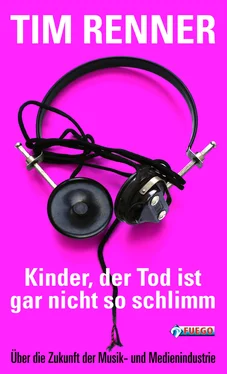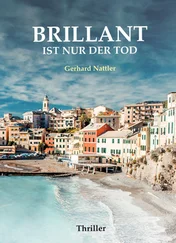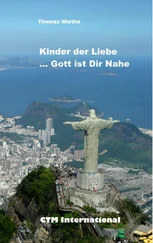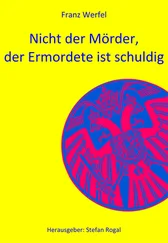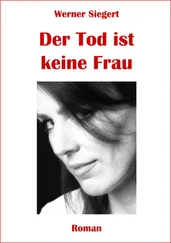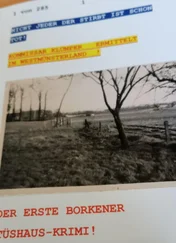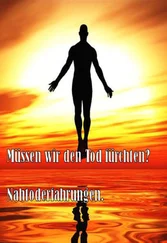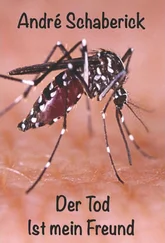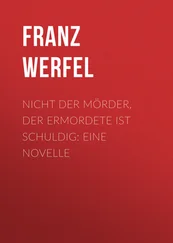Die Organisation, die ich vorfand, war auf dergleichen auch gar nicht eingestellt. Der Herkunftsort, nicht die Inhalte waren entscheidend. Gemäß der altbackenen Logik, der Deutsche macht Schlager, der Brite und der Amerikaner rocken, war die Firma in eine nationale und eine internationale Abteilung aufgeteilt. Doch diese Logik griff seit langem schon nicht mehr. Die nationale Fernseh-Promoterin, die begnadet auf der Klaviatur des Mainstreams spielte, durfte den britischen Schmalzgott Chris de Burgh oder die von ihr verehrten Bee Gees nicht bearbeiten und musste sich stattdessen am Independent-Neurotiker Phillip Boa die Zähne ausbeißen. Dessen sperriges Wesen und Inhalte waren ihr völlig fremd, und in die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck, die sie mit ihrem Charme spielend besetzte, passte er partout nicht rein. Die internationale Presse-Promoterin hätte hingegen liebend gerne Chris de Burgh zum Teufel geschickt und Boa in die Underground-Presse gebracht, durfte aber nicht.
Meine neuen Kollegen hatten fast alle eine Leidenschaft und eine klare musikalische Identität, doch die Organisationsstruktur sah diese nicht vor. Hier führte keiner etwas Böses im Schilde, war kein Masterplan des Konzerns erkennbar. Man hatte lediglich nicht gemerkt, dass die Zeiten sich gewandelt hatten, dass Musiker ungeachtet ihrer nationalen Herkunft aus unterschiedlichen Szenen kamen. Vieles machte man wieder wett, weil alle sich darin einig waren, Musik zu lieben. Man freute sich sogar an den Erfolgen der anderen Plattenfirmen. Wenn dienstagabends die Charts über den Ticker kamen, saß der harte Kern nicht selten im großzügigen Zimmer des nationalen Abteilungsleiters (meines Chefs, der an meinem ersten Tag seinen Letzten hatte und für den einen Nachfolger zu finden eine Ewigkeit dauerte) zusammen und hörte sich in Ermangelung eigener Neueinsteiger die Hitlisten der Konkurrenz an. Auf Platten, die gefielen, wurde getrunken, und wenn es viele gute waren, floss Mumm-Sekt, bis der Morgen graute.
Die Musiker, die ich zu betreuen hatte, wirkten alle nicht glücklich. Viele waren mit Unsummen von der Konkurrenz weggekauft worden und nun in einer Welt gelandet, die sie nicht wirklich verstand. Das wurde durch mich auch nicht gerade besser. Ich hatte die so genannten progressiven Künstler zu vertreten, und das hieß, im Sinne der damaligen Polydor, Popper aus Hamburg, die wie Amerikaner klingen wollten, Buren aus Südafrika, die vorgaben, Briten zu sein, und viele Spätausläufer der Neuen Deutschen Welle. Nett fand ich sie eigentlich alle, die Südafrikaner halfen mir sogar beim Umzug, aber nach meiner Meinung zu ihrer Musik gefragt, konnte ich leider nicht lügen.
Überholt, nicht eigen, also eigentlich überflüssig. Ich hoffe, ich drückte das damals freundlicher aus, aber aus ihren Verträgen wollten sie trotzdem fast alle raus. Und das nicht erst, seitdem ich auf den Plan getreten war. Ich ließ es meist zu, und keiner stoppte mich dabei ...
Einen Musiker unter Vertrag zu nehmen, das versuchte ich später meinen Mitarbeitern immer einzubläuen, hat ein bisschen etwas von einem Adoptionsakt. Das darf man nicht leichtfertig machen, das hat Konsequenzen und bringt Verpflichtungen mit sich. Ein Kind würde man ja auch nicht aus einer Laune heraus unter seine Fittiche nehmen. Ähnlich hilflos steht der unerfahrene Künstler anfangs mit großen Kulleraugen der Maschine Musikindustrie gegenüber. Er braucht jemanden, der ihn und seine Mission versteht, sich damit in der Tiefe auseinandergesetzt hat, seine Anliegen und sein Werk in das System hinein übersetzt und dort auch der Anwalt seiner Interessen ist. Häufig bricht er für die vermeintliche Karriere, die durch den Vertrag am Horizont zu winken scheint, Studium oder Lehre ab. Manchmal schmeißt er deshalb sogar seinen Beruf hin. Der Vertrag ist für den Musiker Chance und Gefahr zugleich. Der Artist & Repertoire Manager muss sich dieser Verantwortung bewusst sein. Der Künstler braucht Kontinuität. Für ihn ist es fatal, wenn sein Ansprechpartner geht. Es ist keinesfalls gewährleistet, dass ihn der Nachfolger, welchem automatisch die Rolle der Stiefmutter zukommt, überhaupt versteht. Besonders nicht in Firmen, die sich nicht nach Genres, sondern nach Herkunftsregion organisieren. Die unterschiedlichen musikalischen Szenen und Gruppen haben eigene Codes, eigene Sprachen. Die mir übertragenen Künstler und ich redeten häufig aneinander vorbei, kamen künstlerisch aus zu unterschiedlichen Welten. Sie waren zudem zermürbt und misstrauisch wegen des ständigen Wechsels der Ansprechpartner. Viele meiner Vorgänger hatten sich schnell wieder aus dem Staub gemacht, als sie merkten, dass dieser Teil der Firma scheinbar den Misserfolg gepachtet hatte. Schützen kann man sich als Künstler vor diesem Problem nicht.
Die Festschreibung der Betreuung durch einzelne Mitarbeiter, die so genannte »Keyman Clause«, lässt keine große Plattenfirma mehr zu. Whitney Houston war wohl eine der Letzten, der es gelang, eine solche Klausel in ihren Vertrag hineinzuverhandeln. Nutznießer war Clive Davis, auf dessen Dienste die Diva bestand. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs – sie spielte damals fast die Hälfte des Jahresumsatzes der Arista ein – wies er seinen Arbeitgeber freundlich darauf hin, was passieren würde, sollte er den Wunsch verspüren, die Firma zu verlassen: Der Vertrag mit Whitney wäre ebenfalls sofort Geschichte. Seiner als Bitte getarnten Forderung, ab sofort an der Firma beteiligt zu sein und 15 Prozent seiner Arbeitszeit jenseits von Arista verbringen zu dürfen, konnte keiner mehr widersprechen. Gleichzeitig war dies das Ende einer jeden Chance auf die »Keyman Clause« in Künstlerverträgen, und das nicht nur bei Arista, der späteren BMG.
Bei den Indies war auch das anders. Zumeist nahm ja der Besitzer selbst den Künstler unter Vertrag und nicht einer dieser Konzern-Talentsucher auf ihren wackligen Stühlen. Dafür hatte man hier natürlich die Gefahr der Ablösung durch Konkurs oder Verkauf, die damals bei den Majors noch vergleichsweise gering war. Ein anderes schlagendes Independent-Argument war die künstlerische Freiheit.
Bei den Major-Labels hatte diese in der Tat keine große Tradition. Ihr Künstlerbild war in Deutschland noch häufig von den goldenen Jahren des Schlagers geprägt. Da wurde meist gesungen, was einem der Produzent im Studio vorlegte, und das eigene Album-Cover sah man oft erst nach Veröffentlichung der Platte. Spätestens seit dem Punk wollten die Künstler aber mitreden, ihre eigenen Songs schreiben, den Sound mitbestimmen, das Image und das Marketing mitsteuern. Und gerne strichen sie auch die Silbe »mit« aus dem vorigen Satz.
Bei der ersten Band, die ich unter Vertrag nehmen durfte, würde alles anders sein. Das war mit mir selbst abgemachte Sache. Wenn sich das System mit aller Macht dagegenstemmen würde – umso besser. Der Verleger meines Enthüllungsbuches würde sich sicher freuen. Aber welchen Künstler wollte ich eigentlich »signen«, wie sie es hier nannten, wen wollte ich verpflichten? Ich tastete mich ran, hatte aber selbst die Schere im Kopf. Ich wollte einerseits die coolsten Bands, die man damals nur finden konnte, aber andererseits irgendwie inhaltlich auch die Erwartungen des konservativen Systems erfüllen. Das Ergebnis ist immer halb-cool. Und halb-cool ist schlimmer als uncool. Das, was ich in die Meetings mitschleppte, war gewagt für die Polydor, aber immer auch ein wenig zu altbacken für die Welt, aus der ich kam. Meine Kollegen merkten zum Glück, dass ich nie wirklich selbst begeistert war, und vermieden durch geschicktes Nachfragen, dass ich den typischen Fehler eines jungen A&R-Managers machte: das zu signen, von dem ich glaubte, dass das System es will, und nicht das zu machen, von dem ich weiß, dass es richtig ist. Das System hat nämlich keine Ideologie. Es will nur Erfolg. Und der kommt am ehesten dann, wenn du weißt, dass du Recht hast. Dann bist du bereit zu kämpfen, dann leuchten deine Augen, dann reißt du andere mit.
Читать дальше