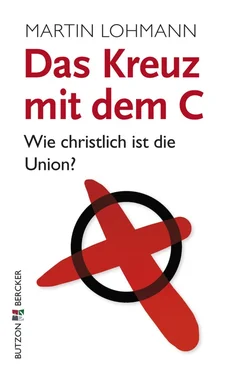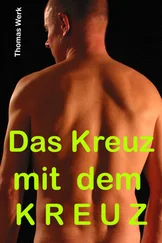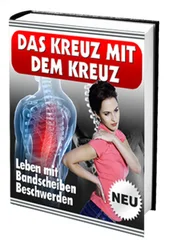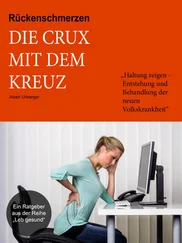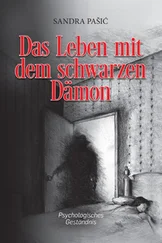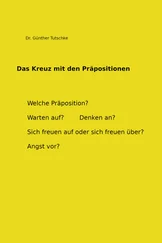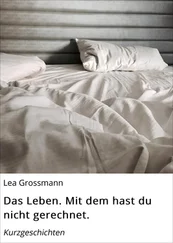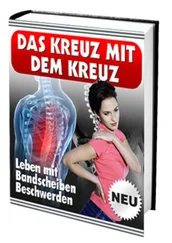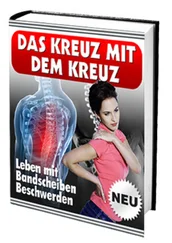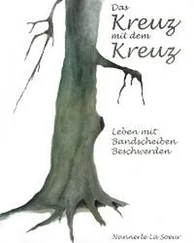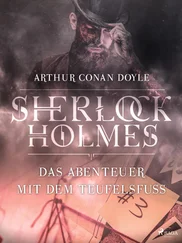Diese Selbstverständlichkeit ist offenbar weithin verdunstet. Heute erscheint es daher schwieriger als früher zu sein, beurteilen zu wollen, was gut und böse, was richtig und falsch nach christlichem Glauben ist. Christliche Sittenordnung – das ist ein nicht mehr verstandener Begriff. Vergessen werden darf übrigens nicht, dass die in der Präambel des Grundgesetzes definierte Verantwortung vor Gott und den Menschen nicht ausdrücklich als ausschließlich christlich gemeint war und ist. Diese Verantwortung schließt alle Gottgläubigen ein, jedenfalls alle, die sich dem alttestamentlichen Gott verpflichtet wissen. Das sind Juden, Christen und Muslime. Letztlich sind es alle, die davon überzeugt sind, dass die Menschenwürde unantastbar sein und bleiben muss und es unverletzliche wie unveräußerbare Rechte geben muss. Der Staat kann nur als humaner funktionieren, wenn er die Natur des Menschen und seiner ihm vorgegebenen Rechte und Pflichten berücksichtigt, sie also nicht der Beliebigkeit anheimstellt. Wo aber sind die Grenzen? Wie weit geht die Freiheit eines Christenmenschen? Wie christlich darf, wie christlich kann und wie christlich müssen die Unionsparteien sein? Gestern, heute und morgen?
So gesehen und weil es keinen Fundamentalismus auf der Grundlage des so beschriebenen Fundamentes geben kann, ist stets zu Recht betont worden, dass es eine christliche Politik nicht geben kann. Wohl aber eine Politik aus christlicher Verantwortung. Wenn schon der Staat mit seinem Grundgesetz weltanschaulich neutral, aber keineswegs wertneutral ist, um wie viel mehr darf und muss ein Anspruch an die C-Parteien formuliert und eingefordert werden? Müssen, dürfen und sollen sie sich unterscheiden von anderen? Wenn ja, wo und wie? Haben sie mehr zu bieten als andere? Können und sollen sie klarer und zugleich toleranter sein als andere politische Parteien? Stehen sie nicht vor einer neuen Herausforderung zur Klarheit, wenn allenthalben erkannt wird, dass – wie es selbst die Zeitschrift „Stern“ bemerkt – es eine neue Sehnsucht nach alten Werten in der Gesellschaft gibt? Stimmt die Beobachtung des Bundesverfassungsrichters di Fabio, dass vor allem die 68er-Bewegung traditionelle und bewährte Werte deformiert und zerstört hat und zu einer „fatalen gesellschaftlichen Bindungslosigkeit“ führte? Ist seine Beschreibung richtig, dass es unserer Gesellschaft „an Identität und innerer Stärke“ fehlt, um in der „Auseinandersetzung mit anderen Kulturen bestehen zu können“?
Wenn ja, wäre und ist es dann nicht gerade eine Herausforderung an die Parteien mit dem C, den vergessenen Schatz zu heben, sich aus den Verneblungen der 68er-Verführungen zu befreien und den Mut zum toleranten Profil der Klarheit zu wagen? Wie viele verdrängte, versteckte und geleugnete Chancen stecken und schlummern im C? Ist das C konservativ oder progressiv oder liberal? Ist alles nur noch Mitte? Und was ist die Mitte? Was kann sie sein? Was muss sie sein? Reicht es, wenn die C-Parteien seit der Wahl 2005 gesellschaftliche Debatten lediglich in möglichst unverbindliche Kompromissmuster münden lassen? Zwingt der Anspruch, eine Volkspartei bleiben zu wollen, gar zu einer profillosen Kompromissverliebtheit? Ist das, was etwa in der Familienpolitik seit einigen Jahren propagiert wird, C-gerecht, fair und human? Kann es – um ein wahrlich umstrittenes Feld des Lebens anzusprechen – im Lebensrecht Kompromisse auf Kosten des Lebensrechtes geben? Embryonale Stammzellen, Patientenverfügung, Sterbehilfe – was haben, was hätten die Unionsparteien hier mehr anzubieten als andere? Was wäre und ist wirklich modern? Wo könnten sich mehr Humanität, mehr Freiheit und mehr Lebensqualität abzeichnen? Ist das C nur ein Kreuz oder ist es vielleicht eine Chance?
C-Politiker geben hier unterschiedliche, nachdenkliche Antworten, fragt man sie nach der persönlichen Bedeutung des C für sie. Der Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Mißfelder, antwortet auf die Frage „Was mir das C für mein politisches Engagement bedeutet“: „Christ zu sein, bedeutet für mich, frei zu sein – frei von Ängsten und Furcht zu sein und stattdessen voller Hoffnung und Zuversicht leben zu können. Sich in der Kirche, in der Gemeinde geborgen zu fühlen. Mein christlicher Glaube dient mir daher als innerer Kompass. Für mich bedeutet das konkret, dass ich mir politische Entscheidungen nicht leicht mache, dass ich abwäge, prüfe und darüber nachdenke, wo die ethischen Grenzen unseres Handelns liegen. Der Mensch darf nicht alles tun, wozu er technisch fähig ist. Das gilt beispielsweise für das Thema Spätabtreibung oder die Humangenetik mit dem wichtigen Bereich der Stammzellforschung. Wir dürfen den Lebensschutz nicht den anderen überlassen, sondern müssen als Union ein eindeutiges Profil zeigen.“
Der junge Bundestagsabgeordnete hätte sich deshalb „auch eine andere Position der CDU bei der Stammzelldiskussion gewünscht“. Die beschlossene Verschiebung des Stichtags hält er „für falsch“ und bekennt: „Wir müssen das Leben von Anfang bis Ende schützen, es in seiner Fülle annehmen. Das ist für mich ein Ergebnis meines christlichen Glaubens, der zwar häufig in der Politik auf die Probe gestellt wird, der sich aber nicht verändert hat durch mein politisches Engagement.“ Der Politiker ist gar davon überzeugt, dass die Union mit ihren „christlichen Prinzipien und der Orientierung an Werten wie Würde, Nächstenliebe und Rücksichtnahme“ sich unterscheide „von allen anderen politischen Richtungen“. Und den Kritikern seiner Partei gibt er gleich einen Rat mit auf den Weg. Sie sollten sich „einbringen und für die christlichen Werte auch politisch einstehen“. Es sei, so Mißfelder, „möglich, das ,C‘ in der Politik hochzuhalten“, zumal dies „in der heutigen Zeit wichtiger denn je“ sei.
Horst Seehofer, der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident, bekennt auf Nachfrage Ähnliches und erklärt zunächst einmal, dass das „C“ im Namen der CSU ein Bekenntnis zum christlich-abendländischen Menschen- und Weltbild sei. Daraus ergebe sich für die CSU „der Auftrag, jeden Tag und jede Stunde dafür zu arbeiten, dass es den Menschen in unserem Land besser geht“. Sein Leitmotiv des politischen Handelns: Politik als Dienst am Menschen. Und dann kommen Formulierungen, die schön klingen, aber eben im konkreten Alltag stets einer Überprüfung unterzogen werden müssen: „Das christliche Menschenbild geht vom Einzelnen aus – von dem Menschen in seiner Würde und Freiheit. In der Schöpfungsgeschichte schenkte Gott dem Menschen einen freien Willen und gab ihm die Fähigkeit, Gutes und Böses zu erkennen und entsprechend zu handeln. Der Mensch ist zur Freiheit und Selbstbestimmung berufen. Dieses Menschenbild erlaubt Unterschiede zwischen den Menschen – es gilt, jeden mit seinen besonderen Stärken zu akzeptieren, ihm freie Entfaltung zu lassen und ihn zu fördern, aber auch Eigenverantwortung einzufordern. (...) Wer alle gleich machen will, wer an den Staat glaubt und nicht an die Kraft des Einzelnen, wer vorgibt, wie die Menschen zu leben haben, beraubt die Menschen der Freiheit.“
Der bayerische CSU-Löwe spricht vom „Rang der Freiheit des Individuums“, erwähnt die „Verantwortung für den anderen, so wie in der katholischen Soziallehre und der evangelischen Sozialethik die Prinzipien der Personalität, Solidarität und Subsidiarität miteinander verknüpft sind“, lobt die Vorzüge der Sozialen Marktwirtschaft und die aus den christlichen Werten erwachsende Verpflichtung „auch zur Verantwortung gegenüber künftigen Generationen“, nennt die Bewahrung der Schöpfung und reklamiert den Schutz von Ehe und Familie. Den Kindern wolle man in den Schulen Werte vermitteln, weil unsere Gesellschaft diese Werte brauche. Auch wenn es „uns als Menschen nicht jederzeit vergönnt“ sei, diese Werte „vollständig selbst zu erfüllen“, seien sie doch als Richtschnur unerlässlich. Für Seehofer heißt das C „nicht Unfehlbarkeit. Es gibt Licht und Schatten. Den Schatten auszublenden, wäre falsch. Regeln sind keine Belastung, sondern eine Hilfe. Aber selbst wenn man sie nicht einhalten kann, bleiben sie eine wichtige Orientierung im Leben“, schreibt Seehofer.
Читать дальше