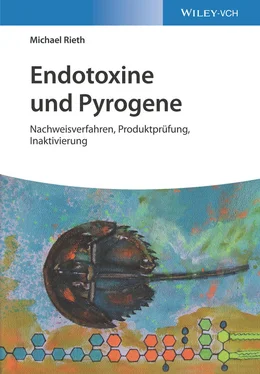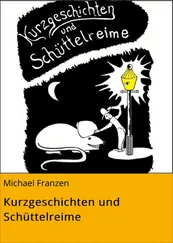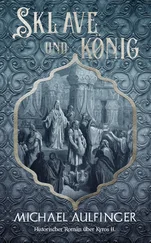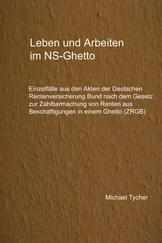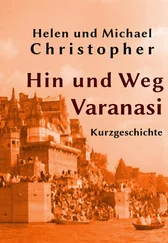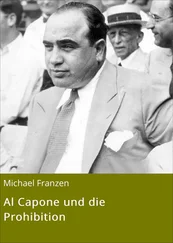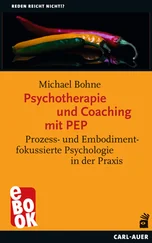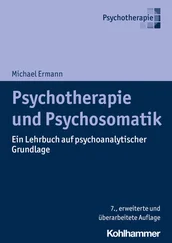Mitte des 18. Jahrhunderts injiziert Albrecht von Haller (1708–1777) Tieren faulige Flüssigkeiten; dies ruft in den Versuchstieren schwere Fieberreaktionen hervor.
Weitere Experimente erfolgen mit Beginn des 19. Jahrhunderts. Die französischen Forscher Gaspard und Cruvelbier injizieren Hunden ebenfalls faulige Flüssigkeiten und schmutziges Hafenwasser; die Tiere erkranken und bekommen hohes Fieber. Der dänische Mediziner Peter Ludvig Panum (1820–1885) untersucht Patienten mit Sepsis und prägt den Begriff „putrides Gift“ (putrid = faulig), womit aus heutiger Sicht Endotoxine gemeint sind. Seine Forschungsergebnisse veröffentlicht er 1874 in Virchows Archiv unter dem Titel „Das putride Gift, die putride Infektion oder Intoxikation und die Septikamie“. Richard Friedrich Johann Pfeiffer (1858–1945), ein Schüler von Robert Koch, entdeckt 1892 bei dem gramnegativen Bakterium Vibrio cholerae ein hitzeunempfindliches Toxin, von dem er annimmt, dass es aus dem Inneren der Zellen stammt; er nennt dies Endotoxin, auch um es von den damals schon bekannten exkretorischen Toxinen, den Exotoxinen, abzugrenzen (siehe auch Abschn. 1.4). Damit ist der bis heute verwendete Begriff „Endotoxin“ geboren.
W.H. Howell (1860–1945) forscht über Blutkoagulation und die Wirkung von Heparin. Er publiziert 1886 in den Mitteilungen der Johns Hopkins University erste wissenschaftliche Beobachtungen, dass die Haemolymphflüssigkeiten der Tiere Limulus polyphemus (engl. horseshoe crab ), Cucumaria spec. (Seegurke) und Callinectes hastatus (engl. blue crab ) koagulieren können (siehe auch Tab. 2.5). L. Loeb führt die Arbeiten von Howell fort und publiziert seine Ergebnisse in den Jahren zwischen 1903 und 1927. E.C. Hort und W.J. Penfold untersuchen das sogenannte „Injektionsfieber“ an Kaninchen und vertreten die Theorie, dass Pyrogene bakteriellen Ursprungs seien. Sie finden, dass pyrogene Substanzen filtrierbar und hitzestabil sind und einen quantitativen Effekt zeigen. Die intravenöse Injektion von pyrogenfreien Salzlösungen in Kaninchen führt zu keinem Anstieg der Körpertemperatur. Hort und Penfold publizieren ihre Ergebnisse im Jahre 1912 [5, 6]. Ihre Erkenntnisse geraten in Vergessenheit, aber die Arbeiten werden in der 1920er-Jahren von Florence Barbara Seibert wieder aufgenommen und fortgeführt [7].
Nach den frühen Arbeiten von Howell und Loeb über die Haemolymphe dauert es bis Anfang der Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts, als Frederik B. Bang die Untersuchungen am „blauen Blut“ des Limulus polyphemus wieder aufnimmt und in den 1960er-Jahren zusammen mit Jack Levin an dem Thema weiterarbeitet.
| 1822 |
Eine der ersten Fossilien der Schwertschwänze wird in Bayern (Solnhofen) gefunden und von Desmarest als Mesolimulus walchii beschrieben. |
| 1862 |
Carl F. J. Zincken findet einen fossilen Schwertschwanz ( Tachypleus decheni ). |
| 1856 |
Peter Ludvig Panum verwendet den Begriff „putrides Gift“. |
| 1862 |
Theodor Billroth benutzt die Bezeichnung „pyrogen“. |
| 1886 |
William Henry Howell beschreibt die Koagulation der Haemolymphe u. a. beim Limulus . |
| 1889 |
G. Roussy isoliert aus gramnegativen Bakterien eine pyrogene Substanz [3]. |
| 1892 |
Richard Friedrich Pfeiffer entdeckt in Vibrio cholerae ein hitzeunempfindliches Toxin, das er Endotoxin nennt. |
| 1894 |
Eugenio Centanni entdeckt in Salmonella typhi ebenfalls ein Toxin, dem er den Namen Piritoxina gibt [4]. |
| 1912 |
E.C. Hort und W. J. Penfold berichten über die pyrogene Wirkung toter gramnegativer Bakterien [5, 6]. |
| 1912 |
Aufnahme des Kaninchen-Pyrogentests in die British Pharmacopeia. |
| 1925 |
Florence B. Seibert entwickelt in den USA den Kaninchen-Pyrogentest [7]. |
| 1942 |
Aufnahme des Kaninchen-Pyrogentests in die USP XII. |
| 1953 |
Frederik B. Bang entdeckt die Auslösung der Koagulation der Haemolymphe des Limulus polyphemus durch gramnegative Bakterien [8, 11]. |
| 1963 |
Zusammenarbeit von Frederik B. Bang und Jack Levin; sie publizieren gemeinsam mehrere Fachartikel, in denen sie den Mechanismus der Koagulation und seine Lokalisation in den Amoebocyten beschreiben und Endotoxine als Auslöser erkennen [9]. |
| 1967 |
Nobelpreis für Physik für H.K. Hartline für Studien am optischen System des Limulus . |
| 1968 |
Frederik B. Bang und Jack Levin beschreiben eine standardisierte Methode zum Nachweis von Endotoxinen. Dieser ursprüngliche Test beruhte auf der qualitativen Endpunktbestimmung der Gelbildung [10]. |
| 1969 |
Beginn der Entwicklung des kommerziellen LAL-Tests durch James F. Cooper und Henry N. Wagner. |
| 1971 |
Vergleichsuntersuchungen von Jack Levin, James F. Cooper und Henry N. Wagner zwischen LAL-Test und Pyrogentest [12]. |
| 1972 |
Cooper et al. setzen den LAL-Test zum Endotoxinnachweis in Radiopharmazeutika ein [13]. |
| 1973 |
FDA publiziert Guidelines für die Herstellung von Limulus-Amoebocyten-Lysat und schlägt Standards vor. |
| 1974 |
Travenol Laboratories (jetzt Baxter) startet Lysatherstellung für eigene Testzwecke. |
| 1974 |
Kobayashi gewinnt Lysat aus Tachypleus (TAL-Reagenz). |
| 1977 |
Associates of Cape Cod (ACC), gegründet von James Sullivan und Stanley Watson, starten ebenfalls die Lysatherstellung. |
| 1979 |
Mahalanabis gewinnt Lysat aus Carcinoscorpius rotundicauda . |
| 1980 |
Aufnahme des LAL-Tests in die USP XX, Monografie „Bacterial Endotoxins Test“, als Referenzstandard wurde Endotoxin aus E. coli O113:H10:K festgesetzt. |
| 1980 |
Gründung von Pyroquant, jetzt ACC Europe GmbH, in Mörfelden-Walldorf. |
| 1981 |
Iwanaga entdeckt den alternativen Aktivierungsweg durch Glucane [15]. |
| 1985 |
Aufnahme des LAL-Tests ins DAB 9. |
| 1987 |
FDA-Guideline, die die verschiedenen Methoden beschreibt, im Juli 2011 zurückgezogen [16]. |
| 1991 |
FDA Interim Guidance, ebenfalls 2011 zurückgezogen [17]. |
| 1993 |
Bundesanzeiger Nr. 2 v. 6. Januar 1993: Bekanntmachung zur Möglichkeit des Ersatzes der Prüfung auf Pyrogene durch die Prüfung auf Bakterienendotoxine nach DAB 10 [18]. |
| 1995 |
Vollblutmodell, Hartung und Wendel, Universität Konstanz. |
| 1998 |
Ph. Eur., USP und JP harmonisieren den RSE aus E. coli O113:H10:K (10 000 IE/Vial). |
| 2001 |
Monografie zum Endotoxintest ist zwischen Ph. Eur., USP, JP harmonisiert. |
| 2003 |
Rekombinantes Reagenz (Faktor C) kommt auf dem Markt (Fa. Cambrex, jetzt Lonza). |
| 2006 |
Portable Test System (PTS) als Kartuschensystem wird von Fa. Charles River zur Marktreife entwickelt. |
| 2010 |
MAT wird in die Ph. Eur. unter der Kapitelnummer 2.6.30 aufgenommen. |
| 2011 |
Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für die Entdecker der Toll-like Rezeptoren Jules Hoffmann und Bruce Beutler.Jules Hoffmann entdeckt, dass Fruchtfliegen ( Drosophila melanogaster ) mit Mutationen im Toll-Gen wehrlos gegenüber Bakterien- und Pilzinfektionen sind. Das Toll-Gen ist für die Synthese von Rezeptoren zuständig. Diese Rezeptoren binden u. a. LPS und lösen so Abwehrreaktionen des Organismus gegenüber den mikrobiellen Eindringlingen aus. Beutler findet diese Rezeptoren auch in Säugetieren; bei Mäusen beschreibt er den Toll-like receptor 4, TLR 4, an den LPS bindet. Dadurch wird eine molekulare Aktivierungskaskade ausgelöst, die den nukleären Faktor Kappa-B (NF- k B) aktiviert. Dieser Faktor wiederum schaltet Gene für Immunaktivatoren wie den Cytokinen an, sodass schlussendlich B- und T-Zellen aktiviert werden und Entzündungsreaktionen und Fieber vorliegen [20]. |
| 2011 |
Fa. Hyglos bringt neuartigen ELISA-Test zum Nachweis von Endotoxinen unter Verwendung eines LPS-selektiven Phagenproteins heraus. |
| 2012 |
Verstärkt anhaltende Forschungen zum LER-Effekt ( low endotoxin recovery ) und zur Maskierung. |
| 2014 |
Hyglos bringt den Endotoxin Recovery Kit (Endo-RS) auf den Markt sowie zusammen mit Microcoat Biotechnologie GmbH einen zellbasierten MAT zur Pyrogendetektion. |
| 2014 |
Haemochrom bringt den Haemotox™ rFC Kit auf den Markt. |
| 2016 |
Ph. Eur. publiziert das überarbeitete Kapitel 5.1.10 im Supplement 8.8; in diesem Kapitel wird der rFC als Alternative zum herkömmlichen LAL-Test vorgestellt. |
| 2017 |
Kikuchi et al. publizieren Vergleichsstudien zwischen drei LAL-Tests und drei rFC Tests und können weitgehend Äquivalenz aufzeigen [21]. |
| 2018 |
Hyglos/bioMerieux bringen als weiteren rFC Test den ENDOZYME II GO auf den Markt |
| 2018 |
Die FDA genehmigt als erstes Arzneimittel den monoklonalen Antikörper Emgalty™ von Eli Lilly, welcher für die Chargenfreigabe mittels rFC auf Endotoxine geprüft wird. |