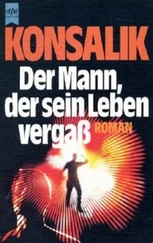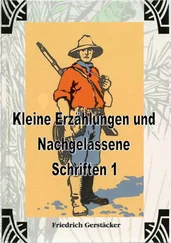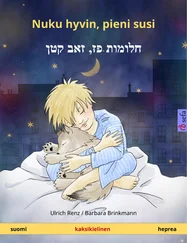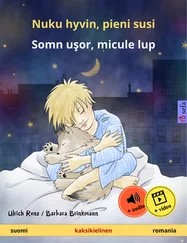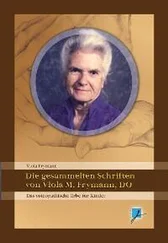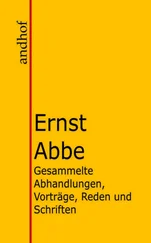Ulrich Sonnemann - Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5
Здесь есть возможность читать онлайн «Ulrich Sonnemann - Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Und dann war da 2011 ›Stuttgart 21‹, der wohl dramatischste und emblematischste Demokratie-Konflikt seiner Art, von dem alle Beteiligten und Beobachter der Meinung sind, daß hier eine historische Epoche ihren Anfang – oder ihr Ende – gefunden hat: das Ende der gehorsamen Hinnahme politisch-administrativer Entscheidungen der politisch-ökonomischen Klasse und den Anfang eines neuen, selbstbewußten politischen Bürgertums. Den inzwischen gebräuchlichen Begriff vom »Wutbürger« würde Sonnemann vermutlich nicht übernommen haben, wohl aber hätte er, so steht zu vermuten, enthusiastisch Stéphane Hessels Appell »Empört Euch« aufgenommen und programmatisch verarbeitet. Von einer schleichenden »Diffamierung des Dagegenseins«14 als einer historischen Konstante der deutschen Identität wird man heute nicht mehr sprechen können: Die »an die Wurzel des Menschseins, des humanen Verhaltens« gehende »Verfemung des Opponierens«15 wurde spätestens ein knappes Halbjahrhundert nach Sonnemanns philosophischem Wachruf historisch überwunden. »1968« hat er noch die Anfänge der Studentenbewegung mit Sympathie und konstruktiver Kritik begleitet und Wege aufgezeigt, für die die ›Einübung‹ ebenso zu zeitig gekommen war, wie es seinen Reflexionen ein halbes Jahrzehnt später ergehen sollte. Im Unterschied zur marxistischen Perspektive der subjektiv revolutionären Bewegung – nach wie vor spannend und lesenswert seine auf hohem Niveau geführte Auseinandersetzung mit Rudi Dutschke (›Dutschke und Augstein‹, 196816) – insistierte Sonnemann jetzt auf der Rekonstruktion des theoretischen und gewaltfreien praktischen Anarchismus, und er gibt sich und eben diese Sache nicht für geschlagen: Die politisierten Studenten, die »ein gewaltloses Deutschland wollen«17, hätten eine taktische Schlappe erlitten, aber »besiegt«, sagt er, »sind sie nicht«18. Wer aber von Gewaltfreiheit spricht, der darf vom Staat nicht schweigen: »Seit Auschwitz ist Problem: der Staat schlechthin.«19 Die praktischen Vorschläge, die Sonnemann der sich formierenden Protestbewegung für ihren Weg öffentlicher Manifestation gibt (»Ausbreitung des Ungehorsams in Deutschland«, 196820) sind geradezu wunderbar konkret: »Gewalt ist nur in Notfällen zu rechtfertigen und auch dann meist prekär. Zur Vorbereitung gegen deren Eintritt ist ihre systematische Diskreditierung, Lächerlichmachung, bis heute in Deutschland noch von keiner Gruppe der Gesellschaft versucht worden. Der Versuch sollte daher gemacht werden.«21
Dieser »Versuch« aber wird seitdem nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gemacht. Seit den 1990er Jahren (es wäre pedantisch und unhistorisch, sich da auf einen Zeitpunkt festlegen zu wollen) hat sich das Phänomen aktiven bürgerlichen Engagements bisher passiver Bevölkerungen weit über Deutschland und Europa hinaus wie ein Buschfeuer ausgebreitet: Von den Massenprotesten gegen den iranischen Wahlbetrug über den »arabischen Frühling« 2011 und die weltweite Occupy-Bewegung bis hin nach Rußland, China und Indien, von scheinbaren Nebenschauplätzen wie Israel oder Myanmar ganz zu schweigen: Diese basisdemokratischen Bewegungen haben überall faszinierend kreative Formen der Subversion staatlicher Autorität hervorgebracht. Keine globale Konferenz ohne lautstarke, spaßvolle, ironisch-entlarvende Kommentierung durch weltweit vernetzte Initiativen vor Ort und damit gegebene Medien-Öffentlichkeit. Für Optimisten ist die Perspektive selbstbewußter Autonomie (Anarchie = Selbstregierung = Demokratie ohne Regierung; siehe David Graeber, ›Fragments of An Anarchist Anthropology‹, Chicago 2004) eine realistische und ernsthafte Hoffnung für das einundzwanzigste Jahrhundert, weil sie auch die Chance enthält, mit jenen gewaltigen Problemen fertigzuwerden, an denen die etablierten politischen Klassen derzeit so schmählich versagen: Klimaschutz, Umwelt, Hunger, Waffenhandel, Ressourcen- und Energie-Verschleuderung bei dramatisch wachsender Weltbevölkerung. Sie können sich dabei – wenn sie es wollen – auf den zu unrecht vergessenen Vordenker Ulrich Sonnemann berufen.
Ekkehart Krippendorff Berlin, im Januar 2012
Wie frei sind die Deutschen?
Gespräch zwischen Ulrich Sonnemann und Dieter Hasselblatt (1964)
Dieter Hasselblatt: Herr Dr. Sonnemann, Sie leben in München; würden Sie gern woanders leben?
Ulrich Sonnemann: Es gibt manche Orte auf Erden, an denen ich von Zeit zu Zeit gern leben würde. So fahre ich etwa – meistens jetzt nur alle paar Jahre – immer wieder mal nach Amerika. Aber im ganzen hat es mich Zeit meines Lebens nach Deutschland gezogen und nach München. Also nehme ich an, daß es seine Gründe hat, auch seine existentiellen Gründe, von denen ich selbst ja gar nicht allzuviel zu wissen brauche, daß ich hier lebe.
Dieter Hasselblatt: Ja, Sie leben aber dann in einem Land, das Sie selber heftig attackiert haben – in Deutschland. Ungefähr gleichzeitig mit dieser ›Spiegel‹-Affäre, die uns alle beschäftigt hat, erschien Ihr Buch ›Das Land der unbegrenzten Zumutbarkeiten‹1. Dieses Land ist Deutschland. Diesem Land kann man, so sagen Sie, unbegrenzt viel zumuten. Für Sie, Herr Dr. Sonnemann, ist Deutschland also ein Land ohne »Rückgrat«2. Und trotzdem haben Sie sich dazu entschlossen, hier zu leben. Ist das kein Widerspruch?
Ulrich Sonnemann: Das ist wahrscheinlich ein Widerspruch, aber, wie ich hoffe, doch einer, den ich ziemlich leicht auflösen kann. Denn für meine Begriffe gehört es eben zu der Loyalität gegenüber einem Volk, einer Gesellschaft, der man entstammt, daß man Zustände, die etwas Intolerables in sich haben und von denen gezeigt werden kann, daß sie dies haben, daß man diese Zustände attackiert und nach seinen Kräften sich bemüht, für ihre Besserung zu sorgen.
Dieter Hasselblatt: Der ›Spiegel‹ nannte Sie im April 1963 Deutschlands »Nationalpsychologen«3. – Sie sind 1912 in Berlin geboren, studierten in Deutschland, in der Schweiz, promovierten 1934 in Basel. Durch das Hitler-Regime wurden Sie gezwungen, Deutschland, und dann durch die Kriegsereignisse auch Europa zu verlassen. In den USA waren Sie als klinischer Psychologe und Professor für Psychologie in New York tätig. Sie machen hier bei uns keinen Gebrauch von Ihrem Professoren-Titel?
Ulrich Sonnemann: Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder in eine Situation komme, in welcher ich von diesem Professoren-Titel Gebrauch machen, auf eine praktische Weise Gebrauch machen kann, insofern ich in einer solchen Situation meine Lehrtätigkeit eben wieder ausüben würde. Aber gerade das Fach, in dem ich sie in Amerika ausübte, ist gegenwärtig von geringerem Interesse für mich. Psychologie war ursprünglich in der Kombination meiner Studienfächer auch durchaus Nebenfach. Es waren wieder mehr Gründe in meiner Existenz-Situation in den frühen Vierzigerjahren, die mich bewogen, drüben die Karriere eines klinischen Psychologen zu ergreifen, der ich allerdings manches verdanke; unter anderem auch eben Einblicke in die Grenzen der klinischen Psychologie und der Psychologie überhaupt.
Dieter Hasselblatt: Sie haben, glaube ich, einige Bücher in diesem Arbeitsbereich, aus diesem Erfahrungsbereich veröffentlicht drüben?
Ulrich Sonnemann: Ja, das letzte war ›Existence and Therapy‹4. Das hat auch in Europa am meisten gewirkt, so um die Mitte der Fünfzigerjahre.
Dieter Hasselblatt: Dann waren Sie aber schon zu uns hier nach Deutschland wieder herüber gekommen?
Ulrich Sonnemann: Das war etwas bevor ich nach Deutschland zurückkam. Ich kam nach Deutschland zurück – nachdem ich vorher schon einmal besuchsweise hier gewesen war, 1950 – im Jahre 1955, und das Buch war 1954 erschienen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ungehorsam versus Institutionalismus. Schriften 5» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.