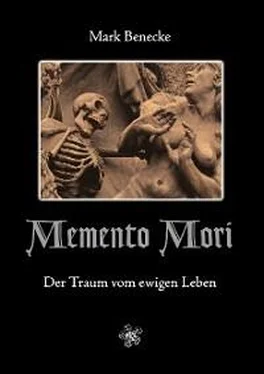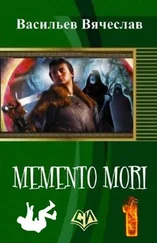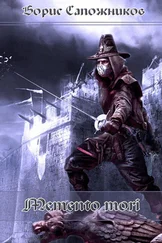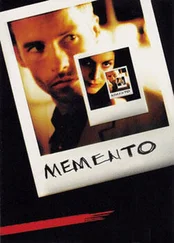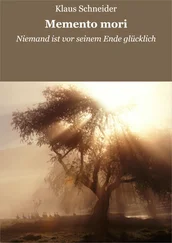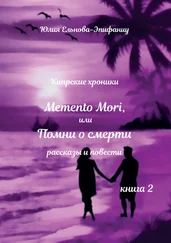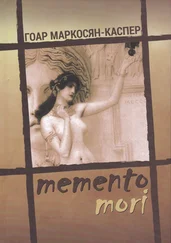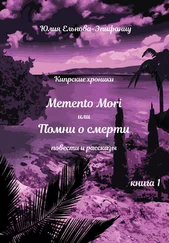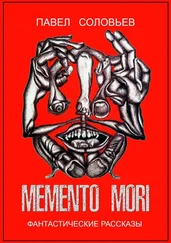228 Dünndarmwände
192 Magenausgänge
25 Hautbedeckungen der Lippen
18 Lebern
8 Luftröhren
6 Harnblasen
Nach etwa sieben Jahren sind wir im wahrsten Sinne des Wortes neue Menschen; nur Nerven und Muskeln werden praktisch nicht erneuert. Dass wir dennoch nicht alle sieben Jahre zart wie Neugeborene aussehen, liegt daran, dass sich erstens nicht alle Zellen gleichzeitig und aufeinander abgestimmt erneuern und dass zweitens ein anderes »Programm« das »Erneuerungsprogramm« überlagert. Es heißt Altern und Sterben, und es führt dazu, dass die Erneuerungsrate und -güte abnimmt.
Gäbe es Letzteres nicht, so könnten sich menschliche Körper möglicherweise sehr lange oder gar ewig erneuern und zellulär verjüngen. Warum also muss der mühsam aufgebaute Organismus nach einigen Jahrzehnten sterben?
Die Antwort auf diese Frage ist der dritte Grund für das in der Erbsubstanz programmierte »freiwillige« Sterben der Lebewesen.
Auch wenn es einem lebenden Erwachsenen nicht einleuchtet, dass er zugunsten seiner Art sterben muss, ist das sozial notwendige Geschehen – eben Altern und Sterben – in seiner DNA vorherbestimmt. Der Grund dafür ist, dass sich während der Entwicklung des Lebens ein über dem Einzelnen stehendes Prinzip entwickelt hat: das der Anpassung an veränderte Umweltbedingungen. Unsterbliche Einzelmenschen könnten diese Anpassung nicht leisten, denn sie würden immer wieder nur sich selbst aus der immer gleichen Erbsubstanz herstellen.
Ändert sich die Umwelt, so können möglicherweise nur solche Nachkommen überleben, die wegen der Vermischung des Erbgutes der Eltern und vielleicht auch durch kleine Zufallsabwandlungen (Mutationen) des Erbgutes besser als ihre Ahnen in das neue Umgebungsgefüge passen. Da niemand vorhersagen kann, welche Art von Veränderung stattfindet – Hitze, Kälte, Wind, Umweltgifte oder vermehrte UV-Einstrahlung –, ist die natürlicherweise auf gut Glück betriebene Zeugung von Nachkommen mit verschiedenen Eigenschaften oft erfolgreich. Eltern, die vielgestaltige Nachkommen in die Welt gesetzt haben, sterben zwar, um ihren Nachkommen im wahrsten Sinne des Wortes Platz zu machen, aber ihre Gene, die sie zum (Groß-)Teil vererbt haben, überleben in den Kindern.
Diese treibende Kraft der Arterhaltung – das Erschaffen und Hegen leicht abgewandelter Nachkommen – steht weit über den privaten Interessen der Einzelnen. Deshalb tragen alle in der heutigen Welt lebenden mehrzelligen Wesen das übergeordnete Hauptprogramm in sich, das es ihnen ermöglicht, zu sterben und zuvor Kinder zu zeugen, die ihnen zwar ähneln, aber nicht völlig gleichen. Dieses Programm ist so fest in der Erbsubstanz verankert, dass es, allgemein gesprochen, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Wie mächtig diese Grundkraft ist, kann man auch daraus erahnen, dass viele Menschen, die keine leiblichen Kinder haben können, einen dringenden Kinderwunsch verspüren.
Es ist die »Stimme der Erbsubstanz«, die dieses Verlangen bewirkt, der oft so genannte biologische Imperativ. – Doch keine Regel ohne Ausnahme. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Lebewesen eine Art Unsterblichkeit erlangen.
Je weiter Biologen und Erdgeschichtsforscher in die Vergangenheit blicken, umso mehr wundern sie sich. Einst wurde die Welt von seltsam aussehenden Tieren und Pflanzen bevölkert. In urzeitlichen Meeren schwamm beispielsweise ein Krebs mit Namen Marrella splendens, der hinter seinen Facettenaugen furchtbare Hörner, so groß wie sein ganzer Körper, trug. Sein Rücken wurde von einem Paar gezackter Gestänge überdeckt, und seine Kiemen ragten seitlich aus der Körpermitte hervor. Übergroße gebogene Antennen erforschten die unwirtliche Umwelt. Das Tier passt in kein gängiges Schema der Biologie. Dabei lebte es vor nur fünfundsechzig Millionen Jahren, im Vergleich zur gesamten Erdgeschichte also vor recht kurzer Zeit. Die Dinosaurier waren gerade ausgestorben, als dieser skurrile Meeresbewohner auf der Bildfläche erschien.
Ein nicht weniger verwunderliches Wesen, das weder Tier noch Pflanze war, lebte weit früher im heutigen Australien, China und England. Es maß über einen Meter im Durchmesser und war vollkommen platt, zehnmal dünner als eine flach auf den Tisch gelegte Hand.
Die Oberfläche dieser Kreatur war ein wenig gefurcht, und in der Mitte war eine Längsachse zu erahnen. Das war alles. Auf der glatten Oberseite waren weder Kopf noch Antennen, Augen, Mund oder Schwanz zu erkennen. Vielleicht hat sich dieses Geschöpf wie unser heutiger Regenwurm fortbewegt – als riesige platte, gerunzelte Scheibe, die sich zusammenzog und wieder streckte. Nach Regenwurmart liefen ihr dabei vielleicht Muskelwellen über den Körper.
Diese Wurmscheiben krochen vor über sechshundert Millionen Jahren unter Wasser auf dem Grund umher, Millionen von Jahren, bevor es Dinosaurier oder gehörnte Krebse gab. Noch nicht einmal Insekten hatten sich zu jener Zeit in die Luft erhoben, und von Fischen war erst recht noch nichts zu erahnen.
Marrella-Krebse und Wurmscheiben erscheinen uns in Gestalt und Lebensweise bereits absonderlich. Aber schauen wir noch weiter in die Geschichte des Lebens zurück: Zu Urzeiten lebten Wesen, die eine noch weitaus merkwürdigere Eigenschaft besaßen. Sie waren beinahe unsterblich.
Das ewige Leben dieser Tiere birgt allerdings einen Widerspruch. Einerseits sterben »ewige Tiere« tatsächlich nicht (wenn sie nicht gewaltsam getötet werden). Es gibt bei ihnen keine Leichen. Andererseits jedoch besteht das einzelne Lebewesen als solches nicht dauernd fort. Alle Nachkommen der unsterblichen Urtiere sind Kopien desselben gemeinsamen Muttertiers, das sich schlichtweg aufteilt. Die kopierten Nachkommen gleichen der Mutter in allem: Vom Körperumriss bis hin zu ihrer Reaktion auf einen bestimmten Reiz, zum Beispiel eine Erschütterung oder einen Lichtblitz. Sie sind perfekte Abbilder ihrer Vorgängerin. Weil man die Nachkommen durch nichts voneinander und von ihrer Mutter unterscheiden kann, nennt man solche Lebewesen Klone (siehe Box »Klonen und Klonieren«).
Die unsterblichen Überlebenskünstler gibt es heute noch. Man begegnet ihnen tagtäglich, ohne es zu bemerken. In einem Tropfen aus einer Pfütze beispielsweise kann man eines dieser Urwesen auch ohne Vergrößerungsglas gerade noch erkennen: die Hydra. Das vielarmige Wesen kann nahezu jede Verletzung wieder ausgleichen, indem es die zerstörten Teile neu bildet.
Der Name der Hydra stammt aus der griechischen Sagenwelt. Dort gibt es ein Fabelungeheuer, dem für jeden ab geschlagenen Kopf mehrere neue wachsen. Auch in anderen Sagenkreisen taucht diese Idee auf, beispielsweise in den Heldengeschichten der Drachentöter. Diesen Sagen liegt eine Beobachtung zugrunde, die man offenbar schon vor einigen tausend Jahren machte. Auch wenn die antiken Berichterstatter mit der Größe des Monsters übertrieben, waren ihre Beschreibungen eine gute Vorlage für die Namensgebung des echten Tieres. In der Wirklichkeit ist es tatsächlich wie in der Sage: Den Hydren bereitet ein abgeschnittener Kopf keine Sorgen – er wächst einfach nach. Man kann eine Hydra sogar in fast beliebig viele Stücke zerschneiden oder durch ein feines Sieb drücken. Aus den kleinen Stückchen entstehen neue Hydren, oder die Stücke finden wieder zu einem gemeinsamen Körper zusammen.
Hydren vermehren sich, indem sie ab und zu kleine Ausstülpungen an ihrem Stiel bilden. Die Knospen wachsen zu neuen Tieren heran, lösen sich vom Elterntier und setzen sich irgend wo fest. Das Elterntier selbst überdauert die Jahrtausende nicht als einzelnes Wesen. Es überlebt in zahlreichen Teilen an verschiedenen Orten.
Eine andere Sorte unsterblicher Geschöpfe könnten so genannte Kugeltiere der Gattung Volvox sein.
Auch sie leben in Tümpeln und Pfützen. Da sie den Blattfarbstoff Chlorophyll in sich tragen, können sie sich mit Hilfe des Sonnenlichts ernähren. Manchmal vermehren sich die hohlen Kugeltiere in Massen und lassen dann ganze Gewässer grün erscheinen. 1981 entdeckten Jeffrey Pommerville und Gary Kochert, zwei Botaniker an der Universität von Georgia, dass jeder Einzelne der kugeligen Teichbewohner nach vier bis sieben Tagen eines natürlichen Todes stirbt.
Читать дальше