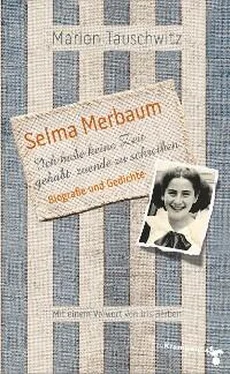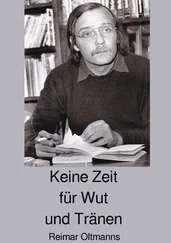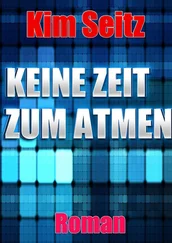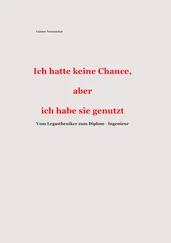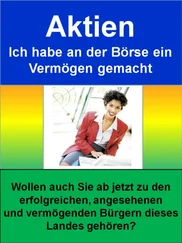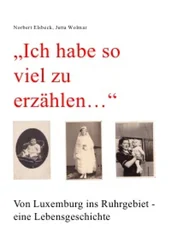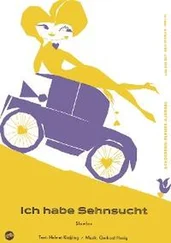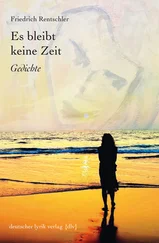Wurden Steinbargs »Lebende Bilder« im jüdischen Kulturhaus aufgeführt, schnappten sich Mütter und Väter ihren Nachwuchs, denn Alt und Jung ließen sich von den Aufführungen gleichermaßen begeistern. Außerdem hatte Elieser Steinbarg einen Riecher für Talente. Mütter vor allem hofften, dass Steinbarg die schlummernden Begabungen ihrer Sprösslinge entdeckte. So wie bei Joseph Schmidt. Der weltberühmte Tenor hatte als Kind bei Steinbarg gespielt und gesungen, bevor seine Lieder schließlich »um die Welt« gingen. Auch wenn der Barde des Jiddischen in Czernowitz nur kurz seine Wirkung entfalten konnte – er erreichte dort Unsterblichkeit.
Grenzenlos war die Trauer, als Steinbarg 1932 überraschend an den Folgen einer Blinddarmoperation starb: die Menschenmenge, die den Sarg begleitete – unüberschaubar. Rose Ausländer schrieb anlässlich der Gedenkfeier im Czernowitzer »Morgenblatt« über den Dichter, » … der allen Wesen und stummen Dingen die verborgenen Zungen löste und sie uns durch eine Sprache und einen Rhythmus nahebrachte, der uns den Atem raubt und in uns Visionen von unendlichen Lebendigkeiten und Märchengestalten erweckt«.34
Und weil er eine geradezu »mystische Begabung« gehabt hatte und Kind unter Kindern geblieben war, wurde Steinbarg auf dem jüdischen Friedhof inmitten der Kindergräber beigesetzt. Auch im Tod sollte er Kindern nahe bleiben.
Sprachvielfalt gehörte für Selma also zum Erwachsenwerden, auch wenn der Alltag Rumänisch forderte.
»Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben – Eine alte Frau kocht Rüben – Eine alte Frau kocht Speck – Und du musst weg!«35,
zählten sie beim »Fangerl-Spielen« auf Deutsch. Und wechselten ungeniert zur snobistischen, dem Französischen entlehnten, rumänisierten Variante:
»Un Dum Dri/Gardez les mezi/Les mezi/Les meseaux/De capelle san-ti-mo/Santimo Teperi/Un Dum Dri.«36
Je nach Anlass schlüpfte Selma in die jeweilige Sprache wie in ein bereitliegendes Kleid. Sie hatte keine Wahl – die Geschichte erzwang das jeweilige Sprachkostüm. Doch darin bewegten sich Kinder ohnehin ungehemmter.
Französisch, Rumänisch, Latein und Deutsch waren Selma als Unterrichtsfächer aus der Schule vertraut. Hätte sie mehr Zeit zum Schreiben gehabt – ihre Dichtung hätte sich mit der Rose Ausländers messen können: beide geprägt von Sprachvielfalt, beiden war Deutsch ihr »Mutterland Wort«, in das sie immer zurückfanden. Es gab aber auch Stimmen, die genau diese Mannigfaltigkeit für den Verlust ihrer Sprachidentität verantwortlich machten und sich letztlich in jeder Sprache fremd blieben: »In welcher Sprache liebe ich, fluche ich, träume ich, klage ich und bete ich – in welcher Sprache wird der Tod mir kommen?«37
Dass die deutsche Sprache ihren Eltern mehr als bloßes Mittel zur Kommunikation bedeutete, wird den Kindern nicht verborgen geblieben sein. Deutsch blieb die Brücke zur alten Habsburger Herrlichkeit. Wenn also Eltern ihre Zöglinge mit deutscher Lektüre ausrüsteten, liebäugelten sie stets auch mit dem dahinterliegenden Bildungsauftrag. »Kultur-Kult« auch bei den Kindergeburtstagen. Lehrreiche Spiele und Geschenke wie Quartette und Sachbücher schätzten die Eltern sehr. Mochten Wochenheftchen wie »Schmetterling«, »Papagei« oder »Kiebitz«38 pädagogische Ziele verfolgen und den Nachwuchs für die Natur sensibilisieren – die Kinder erwarteten sie dennoch sehnsüchtig. Struwwelpeter, Rübezahl, Till Eulenspiegel, Münchhausen und Wilhelm Busch werden Selma wie allen jüdischen Czernowitzer Kindern vertraut gewesen sein. Jungs begeisterten sich für Tarzan und Karl May, die Mädchen wuchsen mit den »Nesthäkchen«-Büchern der jüdischen Schriftstellerin Else Ury auf. Und wenn kleine Mädchen das Glück hatten, in einem begüterten Elternhaus groß zu werden, eiferten sie der Protagonistin Annemarie auch mit Dienstpersonal, Kindermädchen, eigenem kleinen Hund und Singvögeln auf dem Balkon nach. So wie Margit Bartfeld, die später Selmas Klassenkameradin im »Hofmann-Lyzeum« werden wird. Noch im hohen Alter schwärmte Margit von Urys Büchern. Ihre Eltern hatten wie viele andere auch mit dem renommierten Berliner Meidinger Verlag ein Abonnement abgeschlossen: Jede Neuausgabe der »Nesthäkchen«-Bände wurde umgehend frei Haus geliefert.39
Vom Schicksal der Autorin Else Ury wussten die Czernowitzer Kinder damals nichts: dass für eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Weimarer Republik mit Hitlers Machtergreifung alles vorbei war. Dass Ury mit Schreibverbot belegt und 1935 aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen wurde – was das Ende jeglicher Veröffentlichung bedeutete. Enteignet, geknechtet und 1943 nach Ausschwitz deportiert, wurde Else Ury dort unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet.
Selma wird nicht mit teuren Abonnements verwöhnt worden sein. Nach den Schuldenkrisen musste Frieda Eisinger mehr denn je mit ihrem Geld haushalten. Deshalb gab es für Selma weder nachmittäglichen Privatunterricht noch ein eigenes Klavier. Im Gegensatz zur verschwägerten Familie Antschel. Zu einem Klavier für Cousin Paul hatte das Geld zwar auch nicht gereicht, doch auf ein Instrument verzichten wollte seine ehrgeizige Mutter Fritzi dennoch nicht. Und so quälte der kleine Paul sich und die Verwandtschaft einige Monate lang mit einer Geige.
Weil Selmas Elternhaus auch nicht mit einer eigenen Bibliothek aufwarten konnte, stöberte Selma schon früh im Bücherschatz ihrer Freundinnen – und wird das Kulturangebot der »Toynbee Halle« geschätzt haben. Dieses jüdische Volkslehrhaus lieferte jüdischen Kindern jeden Alters Bildung und Lesestoff, bot Lehrlingen Ausbildung und Unterkunft. Es organisierte Vorträge, Kurse und Theateraufführungen. Gastschauspieler aus Bukarest wurden für Opernaufführungen verpflichtet. Purim- und Chanukkafeiern wurden für Kinder jener Familien ausgerichtet, die sich die teuren privaten Feiern in den edlen Czernowitzer Cafés nicht leisten konnten. Sonntags lockte die »Toynbee Halle« mit Märchenaufführungen: »Rotkäppchen« und Andersens »Prinzessin auf der Erbse« waren 1937 der Schlager.40 Selma wird sie gesehen haben. Mit berühmten Ausländern wurden auch weniger Kulturbeflissene gelockt: Als »Pat und Patachon« in Czernowitz auftraten, waren »Stolz und Freude grenzenlos«41.
Die Idee der englischen »Toynbee Halls« hatte der Wiener Philologe Leon Kellner 1900 von England aus erst nach Wien und dann nach Czernowitz exportiert. Kellner lehrte Anglistik an der Universität in Czernowitz und war ein enger Vertrauter von Theodor Herzl, dessen zionistische Ideen er teilte. Die Ideale der englischen Settlement-Bewegung deckten sich mit seiner Weltanschauung.
Wohlhabende Studenten und Graduierte der renommierten Elite-Universitäten Oxford und Cambridge hatten sich Ende des 19. Jahrhunderts in sogenannten »Settlement Houses« zusammengetan, um mit Menschen aus den ärmsten Bevölkerungsschichten im Osten Londons zu leben und zu arbeiten und ihnen so Zugang zu Bildung zu ermöglichen. So waren die »Toynbee Halls« als Kultur- und Begegnungshäuser mit vielgestaltigen Angeboten für die Unterprivilegierten entstanden. Mit der Namensgebung wurde dem Nationalökonom Arnold Toynbee ein Denkmal gesetzt, der einer der ersten gewesen war, der sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen in Londons Elendsquartieren einsetzte.
Im Herbst 1910 gründete Leon Kellner mit der akademischen Verbindung »Hebronia« die Institution »Toynbee Halle« in Czernowitz, die ihr eigenes Haus der Stiftung des jüdischen Czernowitzer Ehepaars Markus und Anna Kisslinger verdankte. Die Crème de la Crème aus Kultur und Verwaltung hatte sich zur großartigen Einweihung am 15. November 1913 eingefunden. Festreden und Gebete huldigten immer auch dem Habsburger Kaiser. »Allgütiger, erhalte und beschütze deinen Gesalbten, der uns Bekenner des Judentums zu treuen Bürgern dieses Staates gemacht, gib, o Herr, langes glückliches Leben, Friede und Freude unserem erhabenen geliebten Kaiser Seiner Majestät Franz Josef I. Amen! Amen!«42
Читать дальше