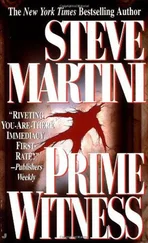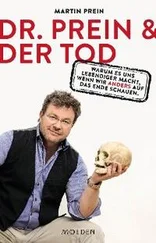Es ergab sich, dass ich in ein modernes Bestattungsunternehmen wechselte, dessen Chef sehr engagiert war. Es war ihm ein Anliegen, dass wir die Hinterbliebenen über die üblichen Angebote hinaus bestens betreuen. Er ließ mir alle Freiheiten und meinte: „Mit deinen Erfahrungen im Rettungsdienst, in der Krisenintervention und in der Psychologie kannst du alles tun, was du für richtig hältst.“ Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Das Erste, wo ich mir sofort dachte, da müsste man etwas ändern, waren die sogenannten Haussterbefälle – also, wenn jemand daheim verstirbt. Meist verständigt dann ein Angehöriger den Bestatter. Dieser nimmt zwar den Anruf entgegen, fährt aber nicht sofort hin, sondern verständigt zuerst den Totenbeschauer. Denn ohne Totenbeschau dürfen die Bestatter den Verstorbenen nicht abholen. 1
In der Praxis lief es so ab, dass der Totenbeschauarzt uns die Uhrzeit nannte, wann er vor Ort sein werde, und wir dann ebenfalls um diese Zeit am Einsatzort waren. Sehr oft kam es aber vor, dass wir vor dem Totenbeschauarzt eintrafen, und dabei bot sich uns immer wieder folgendes Bild: Der Verstorbene lag im Schlafzimmer und seine Witwe saß alleine in der Küche und wartete, bis endlich Totenbeschauarzt oder Bestatter eintrafen. Dieser Zeitraum konnte zwei oder sogar mehr Stunden betragen. Da sagte ich mir: „Dass Menschen in den ersten Stunden nach Todeseintritt eines Angehörigen völlig alleine zu Hause sitzen, geht nicht, das muss uns Bestatter etwas angehen.“ In der Folge rief ich immer, wenn wir über einen Haussterbefall informiert wurden, gleich zurück und sagte: „Wir haben den Totenbeschauer verständigt, der kommt erst in frühestens zwei Stunden und wir auch, aber wenn Sie wollen, kann ich sofort vorbeikommen.“ Das wurde gerade von den Angehörigen, die in dieser Akutsituation alleine zu Hause waren, sehr gerne in Anspruch genommen.
Ein weiteres Angebot, das ich ins Leben rief, war ein persönlicher Brief etwa einen Monat nach der Bestattung. Darin stand, wie es den Betroffenen einen Monat nach dem Todesfall eines geliebten Menschen möglicherweise gehen kann und in dem ich die Möglichkeit eines Entlastungsgesprächs anbot. Viele Angehörige möchten sich „ausweinen“ können, ohne dass jemand aus dem Umfeld (aus Hilflosigkeit der Trauer gegenüber) ihren Schmerz negiert oder relativiert. Mein Angebot sollte den Betroffenen die Möglichkeit geben, über ihren Schmerz des Verlustes zu sprechen oder wortlos darüber zu weinen. Dies eben ohne Worte des „Trostes“, die meistens darauf abzielen, den Schmerzausdruck anzuhalten. Merkte ich bei diesen Entlastungsgesprächen, dass es um „mehr“ geht, für die Hinterbliebenen eine längere Begleitung durch Trauerexperten sinnvoll wäre, konnte ich auf ein gutes Netzwerk von Priestern, Psychotherapeuten und Hospizbegleiterinnen zurückgreifen. In solchen Fällen legte ich den Betroffenen nahe, sich mit einem dieser Experten in Verbindung zu setzen, oder ich stellte für sie den Kontakt her.
Die bisherigen Schilderungen erklären aber noch nicht, wie ich zu meinem Letzte-Hilfe-Kurs kam, der nun in Buchform vor Ihnen liegt. Dazu trug etwas bei, das ich bei meiner Arbeit als Bestatter bemerkte und das meinen Forschergeist zu beschäftigen begann: die Reaktionen auf meinen Beruf. Ein Bestatter kommt ja auch mit anderen Berufsgruppen in Kontakt, mit Einsatzkräften, Pflegepersonal, Ärzten, Polizisten etc. Dabei nahm ich sehr bald wahr, dass viele auf uns mit einer vorsichtigen Distanz bis hin zu unverhohlener Abscheu reagierten. Aus den Gesichtern ließ sich regelrecht ablesen: „Ihr komischen Typen, die ihr die Toten holt, wer weiß, was ihr für welche seid …“
Immer wenn es um geheimnisvoll anmutende oder mit einem Tabu belegte Berufe geht, entstehen Mythen und Geschichten, die an der Wirklichkeit weit vorbeigehen. Ich wollte dem entgegenwirken, indem ich aktiv auf die Leute zuging. Wenn sie wüssten, was ein Bestatter eigentlich macht, würden sie sich vielleicht ein wenig leichter mit uns tun, war meine Überlegung. Es war mir ein Bedürfnis, unseren Beruf und alles, was dazugehört, „sichtbarer“ zu machen, um dieser Scheu ein wenig die Basis zu entziehen. So lud ich diese Berufsgruppen ins Bestattungsinstitut ein, um ihnen tiefere Einblicke zu geben. Die meisten sind meiner Einladung gerne gefolgt.
Und wieder passierte etwas sehr Interessantes, mit dem ich nicht gerechnet hatte: Ich gestaltete die Besuche immer so, dass wir uns zuerst in der Aufbahrungshalle zusammensetzten und ich aus dem Berufsalltag erzählte. Wie wir da so saßen, waren wir uns immer alle einig und nickten uns gedankenschwer zu: „Ja, der Tod gehört zum Leben, die Gesellschaft verdrängt den Tod – aber wir nicht!“ Danach ging es in den Keller und ich zeigte den Besuchern das Sarglager, unseren Obduktionsraum und natürlich den Kühlraum, wo die Leichen aufbewahrt werden. Wenn wir in diesem Kühlraum standen, vor den vielen Türen zu den Kühlfächern, unterlegt vom Surren des Kühlaggregats, dem intensiven Desinfektionsmittelduft und einem Verdacht von Leichengeruch, wurde dieses zuvor in der Aufbahrungshalle geäußerte „der Tod gehört zum Leben“ plötzlich wackelig – ausgelöst durch das Moment der räumlichen Nähe zu den toten Körpern. Das erstaunte mich, und ich sagte den Pflege- oder Einsatzkräften: „Na ja, ihr habt ja auch mit Verstorbenen zu tun, ihr müsst mit den Toten umgehen.“ In den Gesprächen kam dann heraus, dass die direkte und unmittelbare Begegnung mit dem Leichnam doch noch einmal eine andere Nummer ist.
„Die Bewohner im Sterben zu begleiten, das geht“, hörte ich oft von Pflegekräften. Natürlich sei das schon eine große Herausforderung, aber das Thema Palliativtherapie und Hospiz sei mittlerweile gut in Aus- und Fortbildungen verankert. Aber, so der typische Nachsatz: „Hoffentlich stirbt niemand, wenn ich Nachtdienst habe.“ Womöglich in der ersten Nachthälfte, wenn die Leiche erst am Morgen abgeholt wird. Der Tote hinten im Zimmer ist dann doch eine Herausforderung. Erst diese Gespräche über die Begegnung und den Umgang mit dem toten Körper öffneten mir die Augen. Denn uns Bestattern ist das in Wahrheit ja auch nicht immer egal, legen wir doch auch die eine oder andere Bewältigungsstrategie an den Tag.
Mittlerweile hatte ich mein Studium beendet und konnte auch aus wissenschaftlicher Sicht an den Leichnam herantreten, konkreter an das psychologische Phänomen: Was macht der tote Körper eigentlich mit uns Lebenden? Auf der Suche nach Antworten war es ganz interessant, dass der Leichnam in unserer gegenwärtigen Kultur gleichsam nicht existiert. Er ist nahezu unsichtbar und wird relativ rasch dem Blickfeld der Lebenden entzogen. Vielleicht können sich die Betroffenen im Altersheim, im Krankenhaus noch verabschieden, je nachdem, wie es in der jeweiligen Institution gelebt wird. Und alles, was die Hinterbliebenen dann noch haben, sind Pfarrer, Sarg und Friedhof. Dazwischen ist es meistens finster, die Leiche liegt buchstäblich im Dunkeln.
Was ich besonders erstaunlich fand: Der Leichnam kommt in den Sozialwissenschaften und auch in der Psychologie kaum vor. Es gibt tonnenweise Arbeiten und Literatur zum „Vorher“ – zu den Themen Palliativ, Hospiz, Sterbebegleitung und allem, was dazugehört. Und zum „Nachher“, der Trauer. Aber für diesen kleinen Ausschnitt dazwischen, der Begegnung mit dem Körper gewordenen Tod und was er mit uns macht, gab es so gut wie nichts. Und so beschloss ich: Dann mache ich etwas. Ich meldete mich an der Universität für das Doktorat an. Eine Feldforschung, in deren Rahmen ich mir in drei Bundesländern über ein paar Jahre hinweg die sogenannten Leichenberufe näher ansah: Bestatter und Obduktionsassistenten („Kellerprimare“) 2. Meine Arbeit ist mit der eines Ethnologen beziehungsweise Soziologen, der sich in eine bisher unerforschte, fremde Kultur begibt, vergleichbar. In diesem Forschungsfeld interessierte mich: Was machen diese Berufskräfte mit dem Leichnam? Aber noch viel interessanter war zu ergründen: Was macht der Leichnam mit ihnen?
Читать дальше