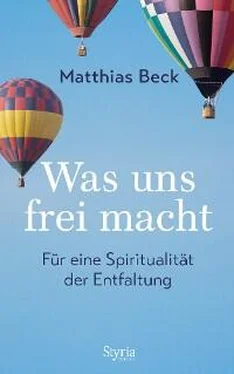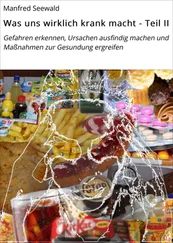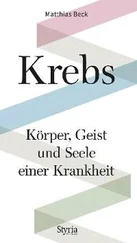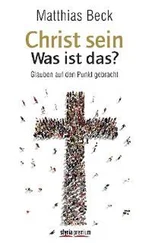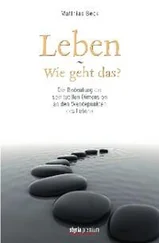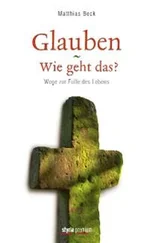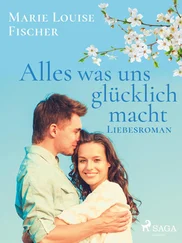Der zitierte Apfelbaum bringt von selbst die Frucht hervor. Der Mensch muss sich zum Fruchtbringen entscheiden. Er kann sein Leben auch absterben und verwelken lassen. Er kann scheitern. Wer Freiheit denkt, muss auch Scheitern denken. Der Mensch kann sein Ziel verfehlen: Das meint der griechische Begriff hamartia . Im Deutschen wird dieser Begriff meist mit Schuld übersetzt, entweder im Sinne des Schuldig-Bleibens oder des Schuldig-Werdens. Jemand bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück, bleibt sich selbst und dem Leben etwas schuldig. Er bringt keine Frucht. Er verdorrt. Er verfehlt sein Ziel.
Wie kommt es zu diesem Fruchtbringen beim Menschen? Es ist ja offensichtlich ein Fruchtbringen, das einerseits von allein geht und gleichzeitig mitgestaltet werden muss. Die Entwicklung und das Werden drängen heran und der Mensch kann mit dieser Lebensbewegung mitschwingen und zur Entfaltung beitragen oder sich dagegen entscheiden. Er sollte versuchen, die innere Entfaltungsdynamik nicht zu blockieren. So geht es um ein Zulassen dessen, was sich von innen entfalten will und um ein Mitwirken daran. Es geht dabei nicht um eine ständige Leistung, die überfordert.
Woher zieht der Apfelbaum seine Nahrung zur Entfaltung? Aus etwas anderem, das er selbst nicht ist: aus der Erde, in der er wurzelt, aus Wasser, Luft, Sonnenenergie. Woher zieht der Mensch seine Nahrung? Auch aus etwas anderem: aus seiner Ernährung, dem Wasser, der Luft, der Sonnenenergie. Aber auch das Seelische braucht Nahrung. Sie bekommt der Mensch aus guten menschlichen Beziehungen: im Kindesalter vor allem von den Eltern, später von Freunden, Lebenspartnern. Beziehungen können aneinander reifen. Das geht nicht ohne Konflikte. Entscheidend für die glückende Reifung ist, dass diese Konflikte immer wieder gelöst und Missverständnisse geklärt werden.
Woher kommt die geistige Nahrung? Offensichtlich aus Geistigem: von Menschen, aus der Schule, aus einem Buch, dem Nachdenken über die Welt, aus Erkenntnis, Selbsterkenntnis, Welterkenntnis, Erkenntnis der letzten Dinge, Dialog mit dem anderen. All diese Dialoge wurzeln letztlich in einem Dialog mit dem letzten geistigen Grund des Seins, dem Göttlichen. Aus ihm wächst alles empor. Er ist die Quelle und der Urgrund von allem.
Derselbe Urgrund des Seins wohnt im Menschen als Seelengrund. 26In diesem letzten Grund darf und soll der Mensch Wurzeln schlagen. Von dort her wächst ihm alles zu: Kraft, Erkenntnis, Einsicht, Verständnis für sein Leben. Auch hier wieder beides: Diese Wurzeln sind schon da, sie bringen Nahrung herbei und doch sollte sich der Mensch diesem Grund immer wieder aktiv zuwenden. Hier kommt seine Freiheit ins Spiel. Darin liegt die eigentliche Entscheidung, die jeder täglich neu treffen kann: sich immer wieder diesem letzten Seinsgrund zuzuwenden, damit aus ihm das Leben sprießen kann und zur Entfaltung kommt. Wenn die menschlichen Wurzeln in gutem Boden verankert sind, wird das Leben auch gute Früchte tragen.
So wie der Mensch täglich essen muss, kann er sich auch immer wieder nach innen seinem Seelengrund zuwenden, still werden und in sich hineinhorchen. Die eigentliche geistig-geistliche Nahrung kommt aus dieser tiefsten Dimension. Es liegt in der Entscheidung des Menschen, sich ihr immer wieder hörend zuzuwenden. Das nennt man zum einen „Reflexion“ ( reflectere : sich nach innen beugen). Der Mensch besitzt die Freiheit, über das eigene Leben, das Leben der anderen und das Leben an sich nachzudenken. Dieses Sich-nach-innen-Wenden kann man auch als Gebet oder Meditation bezeichnen. 27Der Mensch hört in das eigene Innere hinein oder formuliert „nach draußen“ Gebete: still werden, um in der Stille die schweigende Stimme aus dem Inneren zu vernehmen. Reflexion und Gebet können sich durchdringen. Aus christlicher Sicht wohnt im Seelengrund das Göttliche, der gute Geist, der Heilige Geist. Dieser „spricht“ in der Weise des Schweigens. 28Er ist „Teil“ des menschlichen Gewissens, das eine Mischung ist aus weltlichen Stimmen von Vater, Mutter, Schule, kulturellen Prägungen und anderen Über-Ich-Strukturen 29und der göttlichen Wahrheitsstimme. Im Laufe des Lebens geht es immer mehr darum, die weltlichen Stimmen von der göttlichen unterscheiden zu lernen. Die Tradition nennt das die „Unterscheidung der Geister“ (siehe dazu das Kapitel über die Unterscheidung der Geister). In Anlehnung an das Wachstum der Pflanzen beschreibt das Neue Testament diese je neue Zuwendung als ein Bleiben: „Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen, und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt“ (Joh 15, 4-8). Die Verherrlichung Gottes ist das gelingende und fruchtbringende Leben des Menschen. Aber auch das Gegenteil wird gesagt: „Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen“ (Mt 3,10).
Nun kann man fragen, was diese Frucht denn ist. Es ist zum einen die Dynamik der Entfaltung des Lebens mit dem richtigen Beruf (Berufung), der Erfüllung der innerweltlichen Aufgaben, der Entwicklung der inneren Tugenden von Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß sowie der christlichen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe, von denen es heißt, dass die größte unter ihnen die Liebe ist. Und so wird das Fruchtbringen auch mit der Tugend der Liebe verbunden: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf: Liebt einander!“ (Joh 15,16-17)
Du sollst mehr Frucht bringen – Vom Guten zum Besseren
– Die bessere Alternative –
Ein Apfelbaum kann einhundert Äpfel hervorbringen oder zweihundert. Zweihundert ist besser als einhundert. So würde eine innerweltliche Philosophie argumentieren. Man kann mehr Menschen damit ernähren. Wie bringt der Baum mehr Frucht? Vielleicht durch bessere Düngung, bessere Wasserversorgung, mehr Licht, Genmanipulation? Aber geht es um mehr Quantität (mehr Äpfel) oder um mehr Qualität (bessere Äpfel)? Wie kann der Mensch mehr Frucht bringen? Und um welche Früchte geht es?
Oft wird in der Ethik unterschieden zwischen „Gut und Böse“ oder gut und schlecht. Hier geht es um „gut“ und „besser“. Immer wieder geht es im Neuen Testament um dieses Verhältnis: „Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr kümmert es dich nicht, daß meine Schwester die ganze Arbeit mir alleine überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere (Hervorhebung d. Verf.) erwählt, das soll ihr nicht genommen werden“ (Lk 10, 38-42).
„Besser“ heißt in diesem Fall, dass Maria zuerst auf das Wort Jesu hört und dann erst wieder zu arbeiten beginnt. Es ist die Priorität, um die es hier geht: erst das Hören, dann das Tun. In der Sprache der Mönche: erst das Beten, dann das Arbeiten – ora et labora. Oder wie es bei Ignatius von Loyola heißt: contemplativus in actione – betend in der Arbeit. Das bedeutet nicht – wie noch im Mittelalter –, dass das kontemplative Leben in einem Kloster als höherwertig eingestuft wird als das aktive Leben draußen in der Welt, sondern im Alltag die richtige Priorität zu wählen: aus der Stille in die Arbeit, aus dem Sonntag in den Alltag.
Читать дальше