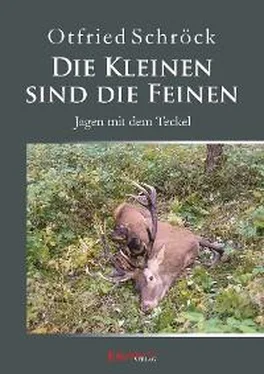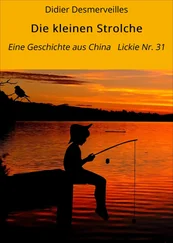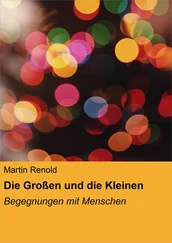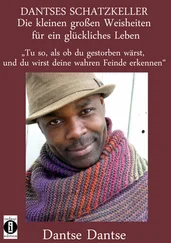Am Rande des schon erwähnten Wildackers habe ich mir einen günstigen Stand ausgesucht. Dieser befindet sich zwischen zwei Brüchern, die „Feld- und Heide-Kranichsluch“ genannt werden. Die Schnepfen streichen gewöhnlich genau an der Waldkante entlang. Schon von weitem vernehme ich die vertrauten Laute und da kommen sie mir auch schon entgegen. Ich reiße die Flinte hoch und werde erst im letzten Moment fertig, als sie schon fast über mich hinweg sind. Der Schuss ist raus und eine Schnepfe fällt hinter mir in einen mehrere Meter breiten Schilfgürtel. Wie soll ich die nur bei dieser Dunkelheit finden? Eine Taschenlampe habe ich zwar dabei, aber groß sind meine Hoffnungen nicht. Da fällt mir der Hund ein, aber Strolch hat eine solche Arbeit noch nie gemacht. Im Vertrauen auf seine Nase und die Leistungen seiner Vorfahren weise ich ihn in Richtung auf den vermeintlichen Fundort ein und er nimmt das Schilf auch sofort an. Eine ganze Weile knistert es im Schilf, es geht hin und her, mal näher, mal weiter, aber immer nicht sehr weit von mir entfernt. Er sucht also konzentriert und lässt nicht nach. Dann kommt er auf mich zu und hat zu meiner großen Freude die Schnepfe im Fang. Natürlich gibt er sie mir nicht vorschriftsmäßig aus und möchte seine Beute gern behalten. Das ist mir aber gleichgültig, ich freue mich unbändig, liebele ihn ab und nehme ihm die Schnepfe aus dem Fang. Es ist übrigens die einzige ihrer Art in meinem Jägerleben geblieben. Jedenfalls finde ich in meinem Jagdtagebuch, das ich in den ersten Jahren meiner Jägerlaufbahn akribisch geführt habe, keinen weiteren Eintrag über eine Schnepfe. Als die Jagdzeit dieser interessanten Vogelart immer mehr eingeschränkt wurde, so dass es sinnlos war, auf den Vogel mit dem langen Gesicht zu warten, bin ich noch oft ins Revier gegangen, nur um den Zauber des Schnepfenstriches zu erleben. Für Strolch war dieses Erlebnis so prägend, dass er Zeit seines Lebens das „Puiz, Puiz“ und „Quorr, Quorr“ der balzenden Schnepfen mit einem ruckartigen Aufwerfen seines Kopfes markierte.
Unweit von diesem Wildacker befinden sich die „Giebelkuten“, zwei giebelartig zueinander angeordnete Tümpel. Ihren Namen haben sie aber sicher von dem Fisch namens Giebel, der eine interessante Fortpflanzungsbiologie hat und deshalb auch in solchen Gewässern überleben kann. Hier lebten neben vielen an das Wasser gebundenen Tieren damals auch mehrere Sumpf-Schildkröten. Eine davon, die Waldarbeiter aufgesammelt und mir gebracht hatten, schmückte zeitweilig mein Terrarium, bis ich sie wieder in der Nähe ihres Fundortes aussetzte. An einem der größeren Tümpel sitze ich heute auf Enten an. Hier ist das Schießen auf die anfliegenden Enten nicht ganz so schwierig, wie in dem Wasserloch, an dem ich mein erstes jagdliches Erlebnis hatte. Es gelingt mir auch, zwei Enten zu erlegen und nun habe ich das Problem, sie zu bergen. Sie liegen ungefähr 20 Meter von mir entfernt zwischen Krautinseln und Entengrütze. Strolch sitzt neben mir und hat das Geschehen aufmerksam verfolgt. Zunächst versuche ich, ihn wie bei der Schnepfe zum Suchen zu animieren. Aber er ist nicht übermäßig wasserfreudig und so habe ich mit meinen Bemühungen keinen Erfolg. Es bleibt mir also nur übrig, im Adamskostüm in dem bauchtiefen Wasser und knietiefen Morast in den Teich zu waten und die Enten selbst zu holen. Die erste Ente apportiere ich ohne Probleme bis ans Ufer, wo sie von Strolch intensiv in Augen - und Nasenschein genommen wird. Er kennt ja noch keine Ente, ist aber sehr interessiert und nun nehme ich ihn an die Leine und lasse ihn neben mir herschwimmen, was er auch bereitwillig tut. Bei der Ente angekommen, nimmt er diese, ohne zu zögern, in den Fang und kehrt mit meiner Unterstützung schwimmend wieder ans Ufer zurück. Nun habe ich also einen Dackel, der zwar ein weißes Fell mit braunen Abzeichen hat, der mir aber unter nicht allzu schwierigen Bedingungen auch einmal eine Ente aus dem Wasser holt. Bei einer späteren Übung mit Hunden unserer Jagdgesellschaft stellt er diese Fähigkeit zum Erstaunen der Vorstehhundeführer im freien Wasser auch unter Beweis.
Auch dieses Erlebnis prägt Strolch für sein ganzes Leben. Ich erinnere mich dabei an einen morgendlichen Gang zum mehr als eine halbe Stunde entfernten Ansitz. Gleich hinter dem Ort unterquert der schon erwähnte Stöbber die Landstraße und verläuft danach ein Stück neben ihr. Wenn Seen und Teiche bereits zugefroren sind, liegen hier über Nacht oft Enten auf dem fließenden Wasser. Es ist noch völlig dunkel und plötzlich kommt es von unten „Paak, Paak, Paak“. Ich achte nicht darauf, denn ich habe ja noch mindestens einen Kilometer Wegstrecke vor mir. Strolch, der bisher neben oder hinter mir hergetrottet ist, stößt mich erst am Hacken an, dann läuft er vor und stellt sich vor mich hin, so als ob er mich fragen will: „Hast Du das nicht gehört?“
Als hätte er nie etwas anderes getan
Wichtiger als das Suchen und Bringen von Federwild war für uns die Arbeit auf der roten Fährte. Mit dem Flintenlaufgeschoss traf man nicht immer so präzise, wie heute mit der Büchse und auf größere Entfernungen ließ die Treffgenauigkeit ohnehin rapide nach. Wer wollte es dem Jäger verübeln, der nach langem Ansitz dann doch noch einen Schuss auf eine Distanz wagte, die für die Brennecke mitunter etwas zu weit war.
Einige Nachsuchen mit Strolch sind mir in guter Erinnerung. So hatte ich bei schwindendem Büchsenlicht auf einen Überläufer geschossen, der in der Nähe des Wildackers aus dem Heide-Kranichsluch auswechselte. In der Aufregung kam ich wohl zu weit hinten ab. Am Anschuss fand ich dunklen Schweiß, der mich Böses ahnen ließ. Ich verbrach den Anschuss und ging nach Hause, um am nächsten Morgen die Nachsuche zusammen mit meiner Mutter und Strolch aufzunehmen.
Meine Mutter, die inzwischen ebenfalls die Jagdeignungsprüfung absolviert hatte, führt Strolch am Schweißriemen. Der Hund hält, als hätte er nie etwas anderes getan, sicher die Fährte. Die war auch nicht allzu schwer, wenngleich der Schweiß immer weniger wurde. Der Rüde führt uns durch Hochwald bis zu einer vielbefahrenen Landstraße, an der wir die Nachsuche unterbrechen müssen. Mein Vater hat im Institut ausländische Kollegen zu Besuch und es ist zu dieser Zeit üblich, dass man sich für die im Ausland empfangene Gastfreundschaft bei Gegenbesuchen reichlich revanchiert. Das geschah vor allem aus zwei Gründen, die sich heute kaum noch nachvollziehen lassen. Zum einen gab es weder im Institut noch in öffentlichen Gaststätten die Möglichkeit, den Gästen früh am Morgen ein Frühstück servieren zu lassen, zum anderen waren die Tagegelder in den Instituten der sozialistischen Länder nicht sehr üppig und man selbst und auch die Gäste wollten das schmale Budget nicht für den Lebensunterhalt, sondern für Mitbringsel ausgeben. Also blieb nur die Bewirtung in der Familie des Gastgebers. Ich selbst habe das später in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit Gästen im Rahmen der Internationalen Zusammenarbeit ebenso gehalten.
Deshalb muss meine Mutter wegen der Gäste nach Hause, um das Frühstück vorzubereiten und ich warte vor Ort. Nach gut zwei Stunden ist sie wieder bei mir und wir setzen die Nachsuche fort.
Strolch führt zunächst eine Böschung hinunter, dann in ein Stangenholz und weiter in ein zu dieser Zeit trockengefallenes Erlenbruch. Hier wechseln sich Erlen Grasbülten, Brennesselhorste und Schilfpartien ab. Ich gehe immer zehn Schritt hinter den beiden her. Als Strolch an einem größeren Brennesselhorst vorbei und meine Mutter mit diesem auf einer Höhe ist, prasselt das kranke Stück seitlich von uns weg. Mit einem schnell hingeworfenen Schuss kann ich den Fangschuss antragen. Der Überläufer, der einen Keulenschuss hatte, war einen Widergang gelaufen und schob sich, wie das kranke Sauen oft tun, neben der Fährte, ein. Im ungünstigsten Fall für Hund und Jäger greift die Sau dann von der Seite her an. Mir fallen mindestens zwei Steine vom Herzen, einer, weil die Sau meine Mutter nicht angenommen hat und ein zweiter, weil der Fangschuss die Qualen des Stückes beendet. Die Nachsuche war mehr als 1000 Meter lang.
Читать дальше