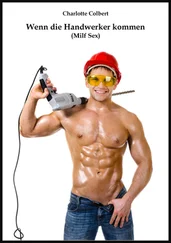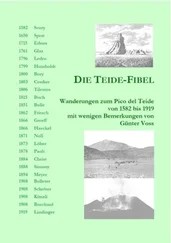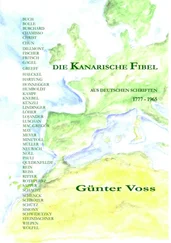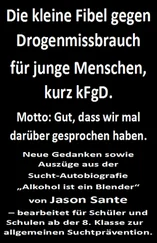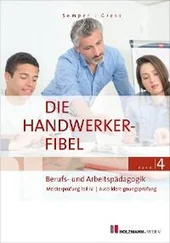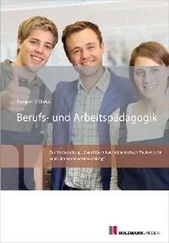Beispiel:
Ein Elektroinstallateur hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Umsatz durch die Erweiterung seiner Leistungspalette um 20.000 € zu steigern (z. B. durch die Installation von Solarmodulen). Hierfür sind Investitionen in neue Werkzeuge, Schulungen und Marketingmaßnahmen notwendig. Insgesamt rechnet er mit einem Investitionsbedarf von 10.000 €. Gleichzeitig möchte er neue Maschinen im Wert von 15.000 € kaufen, um durch schnellere und effizientere Arbeit die jährlichen Kosten um 10.000 € zu senken. Nachdem die Eigenkapitalquote schon sehr niedrig ist, bekommt er von der Bank keinen neuen Kredit, und seine verfügbaren Finanzmittel sind auf 15.000 € begrenzt. Es besteht also ein mittelbarer Zielkonflikt, da beide Ziele nicht gleichzeitig erreicht werden können.
Eine Lösung wäre, dem Aufbau des neuen Tätigkeitsfeldes den Vorrang zu geben und auf die Maschinen zu verzichten (Priorisierung). Alternativ dazu wäre auch eine Satisfizierung denkbar, bei der sich der Unternehmer mit einem Umsatzplus von mindestens 15.000 € und einer Senkung der Kosten um 5.000 € zufriedengibt. Durch die Einsparung von Marketingmaßnahmen sowie den Kauf von gebrauchten Maschinen reicht das Budget zur Finanzierung beider Ziele. Die dritte Möglichkeit, den Zielkonflikt zu lösen, besteht darin, den Zielen unterschiedliche Gewichte zu geben. Bei einer Gewichtung von z. B. 70:30 ergibt sich dann eine Zielfunktion mit folgender Gestalt: Ziel = 0,7 × Umsatzanstieg + 0,3 × Kostensenkung. Die Verteilung der knappen Finanzmittel erfolgt dann so, dass diese rechnerische Zielgröße einen maximalen Wert erreicht.
Zielneutralität
Eine dritte, zumindest theoretisch mögliche Zielbeziehung ist die Zielneutralität. In diesem Fall besteht keine gegenseitige Beeinflussung, das heißt, die Erreichung des einen Ziels hat keine Auswirkung auf das andere Ziel.
In der Praxis sind solche indifferenten Ziele eher selten zu finden, da aufgrund der begrenzten Ressourcen letztendlich alle Ziele eines Unternehmens in einer komplementären oder konkurrierenden Beziehung zueinander stehen. In einigen Fällen ist die Beeinflussung aber so gering, dass sie vernachlässigt werden kann.
Beispiel:
Das Streben des Unternehmers nach gesellschaftlicher Anerkennung oder die Wahrung der Familientradition kann in der Regel ohne großen finanziellen Aufwand erreicht werden. Deshalb können diese beiden Ziele als indifferent zur Gewinnerzielungsabsicht des Unternehmens gesehen werden.
Wiederholungsfragen sowie handlungsorientierte, fallbezogene Übungsaufgaben
1. Ziele sind der Ausgangspunkt einer jeden Handlung. Welche der folgenden Aussagen gelten für Ziele? (2 richtige Antworten)
1 Ziele sind durch menschliches Handeln angestrebte, zukünftige Zustände.
2 Unternehmen haben keine Ziele.
3 Ziele sind ein Maßstab zur Beurteilung des Erfolges von Unternehmen.
4 Es kann immer nur ein Ziel geben.
5 Ziele können in einem Zielkoffer zusammengefasst werden.
>> Seite 13 Handlungsfeld 1: Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen Um im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen Handwerksbetriebe betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Probleme analysieren und bewerten sowie aus den gewonnenen Erkenntnissen Lösungswege ableiten und dokumentieren. Ausgangspunkt sind die Ziele, die mit einer unternehmerischen Tätigkeit verfolgt werden. Darauf aufbauend gilt es, Chancen und Risiken im Umfeld des Unternehmens sowie Stärken und Schwächen des Unternehmens zu erkennen. Hilfreich sind dabei insbesondere die Informationen aus dem internen und externen Rechnungswesen. Bei der Ableitung und Analyse von Unternehmenskonzepten müssen die Rahmenbedingungen beachtet werden, die das Gewerbe- und Handwerksrecht sowie das Handels- und Wettbewerbsrecht vorgeben.
|
2. Ziele sollen möglichst genau beschrieben werden. Helfen kann dabei die sogenannte SMART-Regel. Welche der folgenden Eigenschaften sollten Ziele ihr zufolge haben? (2 richtige Antworten)
1 Sportlich
2 Mitarbeiterorientiert
3 Anspruchsvoll
4 Rational
5 Terminiert.
>> Seite 14|
3. Unternehmensziele sind das Ergebnis eines Entscheidungsprozesses, auf den viele Interessengruppen Einfluss haben können. Wessen Interessen muss die Unternehmensleitung nicht bei ihrer Entscheidung berücksichtigen?
1 Eigentümer
2 Konkurrenten
3 Marktpartner
4 Mitarbeiter
5 Gesellschaft.
>> Seite 15|
4.Ziele haben viele verschiedene Aufgaben. Eine davon ist, Menschen bei einer Entscheidung zu unterstützen.
1 Beschrieben Sie diese Entscheidungsfunktion anhand eines selbst gewählten Beispiels!
2 Nennen Sie drei weitere Aufgaben von Zielen!
>> Seite 15|
5. Nach der Bewertung kann man zwischen monetären und nicht monetären Zielen unterscheiden. Kennzeichnen Sie monetäre Ziele mit „1“ und nicht monetäre Ziele mit „2“!
1 Gewinn
2 Firmenimage
3 Umweltschutz
4 Umsatz
5 Liquidität.
>> Seite 16|
6.Ziele lassen sich nach einer Vielzahl von Kriterien systematisieren.
1 Nennen Sie drei dieser Kriterien, nach denen sich Ziele unterscheiden lassen!
2 Benennen Sie für jedes Kriterium die möglichen Ausprägungen!
3 Nennen Sie für jede Ausprägung eine beispielhafte Zielgröße!
>> Seite 16|
7. Bezüglich des Inhalts von Zielen kann man Erfolgs-, Finanz- und Sozialziele unterscheiden. In den folgenden Aussagen werden den drei Kategorien jeweils zwei Beispielen zugeordnet. Welche Aussagen sind richtig? (2 Antworten sind richtig.)
1 Gewinnziel und Liquidität sind Erfolgsziele.
2 Kapitalstruktur und Finanzierungskraft sind Finanzziele.
3 Rentabilität und Wirtschaftlichkeit sind Erfolgsziele.
4 Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Gewinn sind Sozialziele.
5 Zahlungsfähigkeit und Gewinn sind Finanzziele.
>> Seiten 18bis 21|
8.Sie sind Inhaber eines Handwerksbetriebs und möchten ein Zielsystem aufstellen.
1 Beschreiben Sie kurz, was ein Zielsystem ist und wozu es notwendig ist!
2 Welche Arten von Zielbeziehungen gibt es?
3 Versuchen Sie, folgende Zielgrößen sinnvoll zu systematisieren: Umsatz, Kosten, Werbung, Mitarbeiterzahl, Einkaufspreis, Gewinn!
>> Seiten 21bis 25|
9. Sie sind Inhaber eines Handwerksbetriebs und haben festgestellt, dass ein Zielkonflikt zwischen zweien Ihrer Ziele vorliegt. Was bedeutet dies? (2 Antworten sind richtig.)
1 Beide Zielgrößen können gleichzeitig maximiert werden.
2 Die Erreichung des einen Ziels hat keine Auswirkungen auf das andere Ziel.
3 Der Zielkonflikt kann durch Priorisierung, Gewichtung oder Satisfizierung aufgelöst werden.
4 Eines der beiden Ziele muss zwingend vernachlässigt werden.
5 Die beiden Ziele stehen in Konkurrenz zueinander.
>> Seite 24|
2.Bedeutung der Unternehmenskultur und des Unternehmensimages für die betriebliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit begründen
Kompetenzen
> Merkmale der Unternehmenskultur beschreiben.
> Bedeutung der Unternehmenskultur über persönliche oder soziale Zielsetzungen begründen.
> Gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens im Unternehmensimage kommunizieren.
Das Unternehmensimage, also das Bild, das andere von einem Unternehmen haben, ist ein sehr bedeutender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gerade für die Kaufentscheidung von Kunden ist der gute Ruf eines Unternehmens vielfach entscheidend, aber auch Lieferanten und Kooperationspartner könnten ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit vom Renommee eines Unternehmens abhängig machen. Große Bedeutung haben Unternehmenskultur und -image ferner für das Betriebsklima und damit für die Motivation und Bindung von Mitarbeitern. All das sind wichtige Einflussgrößen der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit. Sie müssen deshalb gründlich analysiert und gezielt gestaltet werden.
Читать дальше