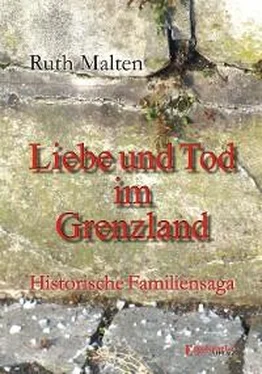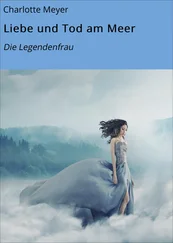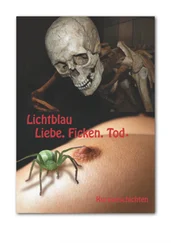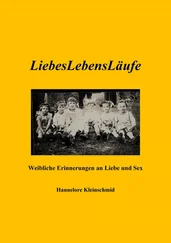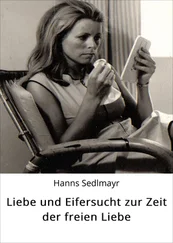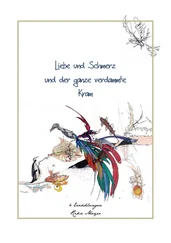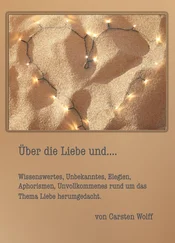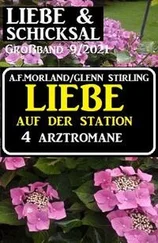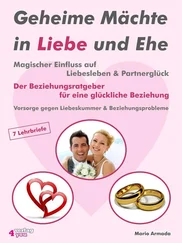Heut ist der Tag, den die Familie herbeigesehnt hat mit neuem Glauben, neuer Hoffnung und neuer Bangigkeit. Bereits sechsmal haben sie ein solches Ereignis hinter sich gebracht. Jedes Mal hieß es, auf das nächste Mal zu hoffen. Hermine und Gustav haben sich für den neuen Hoffnungstag gut angezogen, auch die beiden Kinder wollen mitkommen und haben ihre Sonntagssachen an.
„Wie geht’s, Paul?“, fragt ihn der Augenarzt. Paul ist so aufgeregt, dass ihm übel ist, was man ihm ansieht. Er ist sehr blass. Die blauen Adern an seiner Schläfe treten hervor. Er schluckt wiederholt. Der Arzt legt Paul auf sein Untersuchungsbett und beginnt, den Verband zu lösen. Die Mutter hält Pauls Hand, die sie mit der anderen streichelt. Sie würde gern etwas Tröstliches sagen, lehnt aber leere Worte ab. So sagt sie nur: „Du bist unserer tapferer kleiner Sohn.“
Der Verband ist entfernt. Die Lider beider Augen sind gerötet. Das rechte, jüngst operierte, ist sichtbar geschwollen.
Paul stutzt und stößt einen kleinen Schrei aus. Er blinzelt und zieht die Stirn kraus. „Mama“, sagte er dann und hält sich die Hand vor die Augen. „Paul, was ist?“, fragt sie aufgeregt. „Es ist so hell, das tut weh.“ Der Arzt legt eine dunkle Brille über Pauls Augen. „Was siehst du?“, fragt der Arzt, der sich dicht über Paul gebeugt hat und hoch angespannt ist. „Es ist hell!“, ruft Paul und zittert vor Aufregung. Der Arzt schaut das Kind an, sieht seine Erregung und legt ihm eine Hand auf die Stirn, die andere auf seine Brust. „Ganz ruhig, mein Kleiner“, sagt er besänftigend. „Erzähl mal, was du jetzt siehst.“ Die Mutter beugt sich dicht über ihren Sohn und sagt: „Paul, siehst du mich? Fass mal dahin, wo du etwas siehst.“ Paul greift mit seiner rechten Hand in ihr Gesicht und hält ihre Nase fest. „Meine Nase“, sagt die Mutter und bricht vor Glück und Freude in Tränen aus. „Ich sehe eine Nase“, sagt Paul und tastet jetzt zum Vergleich in sein eigenes Gesicht. Dann fasst er wieder in das Gesicht seiner Mutter. „Eine große Nase.“
Gustav tritt hinzu und spricht mit Paul: „Schau mal, dein Vater, erkennst du was?“
„Alles ist sehr hell, und da drin sehe ich einen großen, dunklen Kopf.“ Auch Hermine schluchzt aus tiefster Seele. Gerade hat der siebenjährige Paul den Umriss seines Vaters zum ersten Mal gesehen.
„Es ist geschafft“, sagt der Arzt und gratuliert Hermine, Gustav, Arthur und der kleinen Ilse. „Euer Bruder kann sehen“, sagt er zu den Kindern, „und wird von Tag zu Tag besser sehen können.“ Die Kinder nehmen Pauls Hand und streicheln sie. Ein Augenblick von großem Glück und Segen liegt über der Familie. „Danke, lieber Gott“, sagt Paul ganz leise. „Amen“, sagt Gustav, flüsternd vor Ergriffenheit.
Der Arzt erläutert den Eltern, die Bilder, die Paul wahrnehmen könne, seien zunächst verschwommen, das Erlebnis der ungewohnt großen Helligkeit lasse im Augenblick noch alles unschärfer erscheinen als in einigen Wochen, wenn das Auge sich an das Licht gewöhnt habe.
Der Arzt machte einen ersten Test für eine Sehhilfe, die Pauls Augenbilder erheblich schärfer gestalten würde. Die Brille würde nach und nach, dem Ausheilen folgend, individuell angepasst. Paul würde eine normale Schule besuchen können.
Im selben Jahr wurde er an der Grundschule angemeldet. Er gewöhnte sich an die Brille. Er erfuhr, dass ein Junge mit Brille, war er dazu noch klein und zart, bei seinen Mitschülern nicht besonders angesehen ist. Insbesondere beim Sport war er derjenige, der bis zuletzt dastand, wenn zwei Mannschaften von zwei starken Schülern ausgewählt wurden. Er wollte alles ändern, was er mit seinem eisernen Willen ändern konnte. Von seinen Eltern wünschte er sich Hanteln und einen Expander. Sein Vater unterstützte seinen Eifer und schenkte ihm ‚Müllers Handbuch der Athletik‘, ein Buch, in dem zahlreiche muskelbildende und kräftigende Übungen abgebildet und beschrieben waren. Paul war fest entschlossen, kräftig und sportlich zu werden. Die Brille war unabänderlich, für ihn aber ein Himmelgeschenk, trug sie doch den entscheidenden Teil dazu bei, ein normales Leben führen zu können. Die Nachteile, was seine Mitschüler anbelangte, nahm er in Kauf. An Worte wie Brillenschlange hatte er sich bald gewöhnt und konnte darüber lachen. Er wusste, dass es Schlimmeres gab, eine Welt ohne Licht und Augenbilder beispielsweise.
2. Kapitel
Adelheid ist dagegen
1903 Breslau
Helene befand sich in höchster Aufregung. Sie hatte rote Flecken am Hals, ihre Haut glänzte feucht. Haarsträhnen hatten sich aus ihrem Knoten im Nacken gelöst und hingen wirr um den Hals. Sie fuchtelte mit den Armen durch die Luft, dann griff sie an die Schläfen: „Wenn du jetzt gehst, bringe ich mich um“, platzte es verzweifelt aus ihr heraus. Elise kannte ihre Mutter gut genug, um zu wissen, es ging ihr schlecht. Helene stand mit zitternden Lippen vor der Tochter und wischte die silberblonde Haarsträhne aus dem Gesicht. „Ich kann nicht mehr“, flüsterte sie, „bin am Ende.“ Sie schüttelte den Kopf. Ihre Stimme zerbrach bei den letzten Worten. Sie nahm Elises Hand und drückte sie gegen ihre Brust. Sie schluchzte, konnte nicht verhindern, dass Tränen quollen und ihre Schultern bebten. Mit beiden Händen bedeckte sie ihr Gesicht. Sie schämte sich vor der Tochter, weil sie sich so gehen ließ.
Einerseits verstand Elise die Mutter. Andererseits spürte sie tief innen, sie musste sich von Helene lösen, die sich dermaßen an sie klammerte.
Helene hatte vor siebzehn Jahren Elise geboren. Deren Mutter hatte sie nicht aufgeklärt. Über gewisse Dinge sprach man nicht. So war ‚es‘ passiert. Wenn sich ein Kind anmeldete, trug die junge Mutter die ganze Last. Dazu die Häme der Mitwelt. Helene, die außer Arbeit bis zu ihrem 17. Lebensjahr und einer von Mühsal geprägten Atmosphäre zu Hause wenig Anregendes kennengelernt hatte, ahnte etwas von Glück, Liebe und Familie, als er ihr begegnet war. Die gute Zeit, in der Gefühle einen Raum hatten, war zu Ende, als sie ihm mitteilte, schwanger zu sein. Da war er aus ihrem Leben verschwunden.
So war das also mit der Liebe, resümierte Helene für sich und schloss für den Rest ihres Lebens dieses Kapitel. Ich werde es allein schaffen, beschied sie und fand eine Arbeit, mit der sie für sich und ihre Tochter Elise den Lebensunterhalt bestreiten konnte. Da sie wegen des Kindes an das Haus gebunden war, nähte sie Militär-Uniformen im Akkord. Die Bezahlung war schlecht. Gesteigert konnte sie nur durch ein erhöhtes Arbeits-Pensum werden. Die Zeit, um zu Fuß die Stoffe bei einem Depot abzuholen und die fertigen Uniformen dorthin zu bringen, ging von der Zeit für das Nähen ab.
Kaum war Elise in der Lage, den Weg zwischen Depot und ihrem Zuhause mit einem für ein Kind viel zu schweren Paket in der Hand zu bewältigen, war es ihre Aufgabe, das Material abzuholen und die fertigen Uniformen als Paket verpackt wieder im Depot abzuliefern.
Helene arbeitete überwiegend bis in die Nacht, um ihre kleine Unabhängigkeit von ihrer eigenen Mutter zu behalten. Als Elise ins Schulalter kam und Zeit brauchte für ihre Hausaufgaben, musste sie dafür kämpfen, überhaupt in die Schule gehen und am Nachmittag ihre Hausaufgaben erledigen zu können. Helene war von der jahrelangen Überarbeitung inzwischen so erschöpft, dass sie für die Bedürfnisse ihrer Tochter kaum noch Verständnis aufbrachte. Schule, Hausaufgaben, Schönschreiben? Unzumutbarer Luxus, fand sie. So entging ihr, dass Elise an jeder Art von Bildung ein hohes Interesse zeigte. Sie wollte lesen, ein Instrument lernen, stellte viele Fragen, die Helene nicht beantworten konnte. Helene war müde und schuftete ständig an ihren Grenzen. Sie brauchte Elise als Hilfskraft. Elise konnte inzwischen schon kleinere Näharbeiten wie Knöpfe annähen, Kanten säumen neben ihren Botengängen ausführen.
Читать дальше