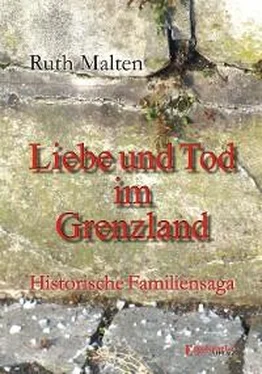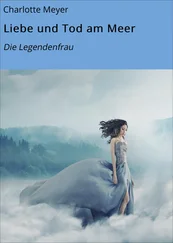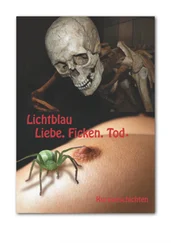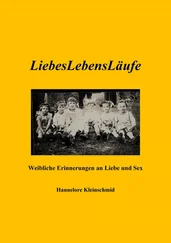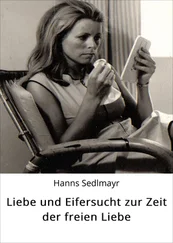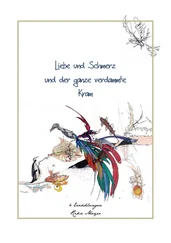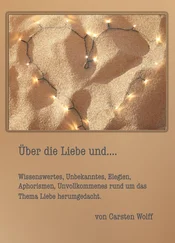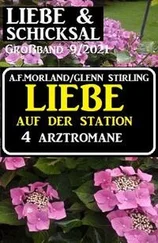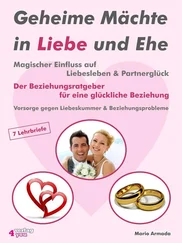Emma hatte, seit sie eigenes Geld verdiente, ein Wirtschaftsbuch geführt, um verfolgen zu können, wo ihr Geld geblieben war. So konnte sie eines Tages die Preisentwicklung nachvollziehen. Aus ihren Notizen und ihrem Wirtschaftsbuch gingen die folgenden Daten hervor, die sie am Jahresende 1923 anlässlich einer kleinen internen Silvesterfeier mit spendierter Extrascheibe Brot von ihrem Chef und einer heißen Tasse Pfefferminztee ihren Kollegen vorlas:
„1914 betrug der Preis für einen Dollar 4,20 Goldmark. Im Jahr 1923 kostete ein Dollar 4,21 Billionen Goldmark. Gegenwärtig ändert sich der Preis eines Dollars fast stündlich. Im Januar 1923 betrug der Preis für ein Brot 250, im August 69.000, im September 1,5 Millionen, im Dezember 399 Milliarden Goldmark.
Im Juni 1923 kostete ein Ei 800, ein Pfund Kaffee 26.000 – 36.000 Mark, im Dezember 1923 ein Kilo Kartoffeln 90 Milliarden, 1 Ei 320 Milliarden, ein Pfund Butter 2.800 Milliarden, ein Zentner – Briketts 1981 Milliarden Goldmark.“
Die meisten Kollegen schütteln fassungslos den Kopf. Weil diese Preisentwicklung derart aberwitzig ist, können einige mit Galgenhumor darüber lachen in völliger Ohnmacht und dem Gefühl, diesen undurchschaubaren Mechanismen ausgeliefert zu sein, die sich verselbständigt zu haben scheinen.
1924 streiken 140.000 Metaller gegen Lohnkürzungen und geplante Arbeitszeitverkürzung und werden ausgesperrt. 1927 wird der Achtstundentag zur Regel. Wer mehr arbeitet, kann Lohnzuschüsse erhalten. Die Arbeitslosenzahl sinkt auf 700.000.
Der Betrieb Meier & Söhne hat die dramatische Zeit nicht überlebt. 1924 ging er in Konkurs.
Emma fand eine neue Stelle im Lungensanatorium in Bad Reinerz als Bürokraft, teils für Buchhaltung, in der sie inzwischen erfahren war und als Schreibkraft für den Chefarzt, für den sie nach Stichworten den Schriftwechsel erledigte.
Viele Soldaten waren lungenkrank aus dem Krieg heimgekehrt. Die Betten in den Sanatorien reichten kaum für alle Kranken. Die völlig unzureichende Ernährung und die schlecht oder nicht geheizten Räume hatten auch in der Zivilbevölkerung zu schweren Lungenschäden geführt. Viele Menschen, die wegen Arbeitslosigkeit ihre Kohlen oder ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten, waren in den kalten Hungerwintern in ihrer ungeheizten Wohnung, einem Hauseingang oder auf einer Parkbank verhungert und erfroren. Die Suppenküchen reichten nicht aus, um für jeden Hungrigen oder Frierenden einen Teller heißer Wassersuppe aus Kohlrüben und Kartoffeln bereitzuhalten.
Emma war nicht nur eine verlässliche Mitarbeiterin im Sanatorium, sie war auch eine Bereicherung an den Patientenabenden mit Gesangsbeiträgen sowie ihrem Klavier- und Zitherspiel. In der Berglandschaft um sie herum ergaben sich in den Wintern Möglichkeiten zum Skifahren und Rodeln, die sie und ihre Kolleginnen nutzten.
In ihrer Breslauer Zeit ohne ihre Familie hatte sie ihre Besuche bei Tante Selma wieder aufgenommen. Tante Selma gab jungen Frauen, die allein in der Stadt lebten, die Möglichkeit, sich mit den schönen Künsten zu beschäftigen. Sie lasen mit verteilten Rollen Texte klassischer oder moderner Literatur, besprachen deren Inhalt und konnten sich zuweilen mit der einen oder anderen Rolle identifizieren. Sie bekamen Einblick in die Grafologie, da Tante Selma als vereidigte Grafologin am Amtsgericht in Breslau ein fundiertes Wissen aufzuweisen hatte. Die sechs bis acht jungen Frauen, die regelmäßig in ihre Gruppenstunden kamen, waren begeistert von der Aussagekraft einer Handschrift und deuteten gegenseitig ihre Handschriften, für sie eine neue Möglichkeit, Näheres über einen Menschen zu erfahren.
Da Tante Selma außerdem als Schriftstellerin arbeitete und mehrere Bücher veröffentlicht hatte, versuchten sich Emma und ihre Freundinnen auch darin, eigene Texte zu verfassen.
Sie betrachteten Bilder großer Meister und lernten gute von weniger guten Werken zu unterscheiden. Sie sangen Volkslieder zur Laute oder das eine oder andere Kunstlied mit Klavierbegleitung.
Sie schufen sich auf diese Weise eine neue, unerschöpfliche Innenwelt parallel zu der Welt politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen draußen. Diese Welt des Geistes und der schönen Künste half ihnen abzutauchen, ihre Mitte wiederzufinden und gestärkt in den Arbeitsalltag zurückzugehen. Emma spürte, hier bekam ihre Seele die Kraftnahrung, die sie brauchte, aber im normalen Alltag nicht mehr fand, weil die Sorgen und Bedrückungen zu groß geworden waren. Die jungen Frauen trugen diese neu gewonnenen Kraftquellen für Zufriedenheit, ja sogar Glück, in ihre Familien, zu ihren Müttern und Geschwistern und halfen ihnen, ebenso diese Zeiten großer Not besser zu durchstehen.
10. Kapitel
Paul besucht Tante Selma von Görlitz aus in Breslau
Die rotierenden Pleuelstangen der Dampflok schufen den gleichmäßigen Takt, der sich im Zug rollend und vibrierend Holzbänken und Fußboden mitteilte. Er fuhr Paul in die Glieder und dünkte ihm wie ein zweiter Herzschlag neben dem eigenen. Herzschlag des Lebens, sinnierte er, von außen kommend, unabänderlich und als gegeben hinzunehmen. Eine Metapher für sein gegenwärtiges Leben, das sich anscheinend ohne sein Einwirken wundersam gefügt hatte. War alles Zufall? Er neigte dazu, an Schicksal zu glauben.
Vor seinem Bahnfenster waberten grauweiße Rauchschwaden aus dem Schornstein der Lok und vernebelten die Landschaft ganz oder teilweise. Auch hier Symbolik, glaubte Paul: Die Zukunft, sich teils andeutend, teils verborgen in Nebelschwaden. Zurückschauend ein ähnliches Bild: Manches klar leuchtend, anderes ganz oder in Teilen entschwunden.
Paul war auf dem Weg von Görlitz, seinem neuen Wohnort, zurück nach Breslau, der Stätte seiner Kindheit, die er vor dreizehn Jahren zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern verlassen hatte. Vater Gustav hatte in Allenstein seinen ersten eigenen Betrieb aufgebaut. Durch den Krieg, der den Polnischen Korridor aus Posen und Westpreußen als Ergebnis des Versailler Vertrages schuf, und die daraus entstandene Insellage Allensteins in Ostpreußen mit Zollschwierigkeiten an zwei neuen innerdeutschen Grenzübergängen, war sein Handelsbetrieb ins Schlingern geraten und nicht zu halten gewesen. Die Familie hätte vom Ertrag nur unter großen Opfern überlebt.
Mehrere Ereignisse waren eingetroffen, die sich so ineinanderfügten, dass Gustav und Hermine ein Schicksal, das ihnen hier den Ausweg wies, am Werke wähnten.
Als Arthur, im letzten Kriegsjahr verschüttet, kriegsversehrt dem Lazarett übergeben wurde, hatte Paul alle Pflichten seines älteren Bruders übernommen. Die beträchtliche Mehrbelastung war für einen Schüler der Oberstufe des Gymnasiums dauerhaft nicht durchzuhalten. Paul war durch die gesundheitlichen Belastungen während seiner frühen Jahre noch immer schmächtiger als seine Altersgenossen. So brach Paul ein Jahr vor dem Abitur schweren Herzens, aber notgedrungen und zum Bedauern seiner Lehrer, er war fleißig und begabt, die Schule ab. Seine ganze Kraft widmete er nunmehr dem väterlichen Betrieb und erhielt seinem Bruder bis zu dessen Rückkehr den Arbeitsplatz.
Als Arthur soweit genesen war, dass er, anfangs stundenweise im Büro, später wieder in allen Bereichen, wirken konnte, kam es zunehmend zu Reibereien zwischen den beiden nun erwachsenen Brüdern. Arthur, als der Ältere, versuchte wieder und wieder, sich als Juniorchef aufzuspielen. Paul, den Jüngeren, aber Begabteren von beiden, verdross zunehmend, dass Arthur aus seinem Altersvorsprung Vorrechte ableitete. Dem Vater glückte immer seltener, Frieden zwischen den Brüdern zu stiften. Seine Aussöhnungsbemühungen gab er eines Tages auf und überließ die Streithähne sich selbst.
Paul arbeitete gut und schaffte viel. Die Dauerspannung mit Arthur kostete ihn jedoch mehr wertvolle Kraft, als ihm zu Gebote stand.
Читать дальше