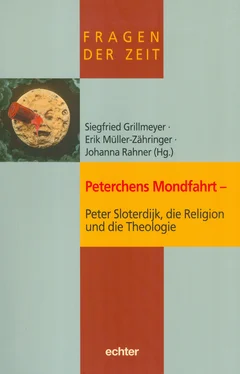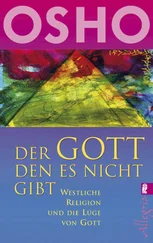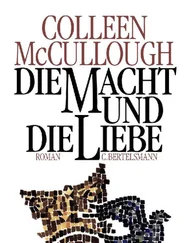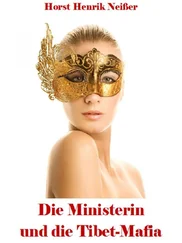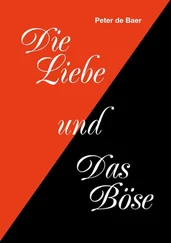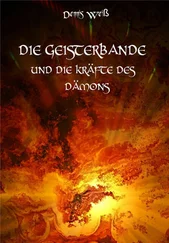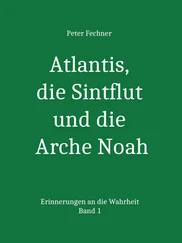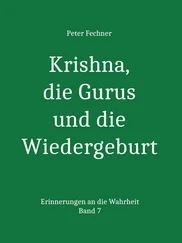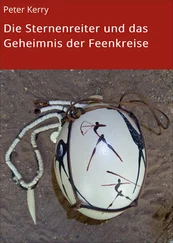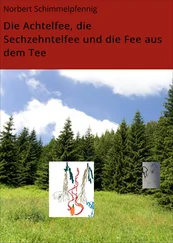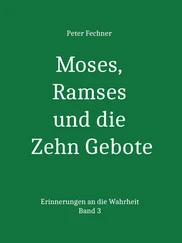„Diffusion des Wissenssubjekts […], so daß der heutige Systemdiener durchaus mit der rechten Hand tun kann, was die linke Hand niemals erlaubte. Des Tags Kolonialisator, des Abends Kolonialisierter; von Beruf Verwerter und Verwalter, als Freizeitperson Verwerteter und Verwalteter; offiziell Funktionszyniker, privat Sensibilist; […] objektiv Zerstörungsträger, subjektiv Pazifist; an sich Katastrophenentfeßler, für sich die Harmlosigkeit selbst. Bei Schizoiden ist alles möglich, und Aufklärung und Reaktion machen nicht mehr viel Unterschied. Beim aufgeklärten Integrierten – in dieser Welt cleverer instinktiver Konformisten – sagt der Körper nein zu den Zwängen des Kopfes, und der Kopf sagt nein zu der Art und Weise, wie sich der Körper seine komfortable Selbsterhaltung erkauft. Diese Gemischtheit ist unser moralischer Status quo.“ 70
Der moderne Zyniker macht weiter, wo im emphatischen Sinne gar nichts mehr zu machen ist. Es scheint keine Alternative in Sicht. 71„Zynismus ist das aufgeklärte falsche Bewußtsein – das unglückliche Bewußtsein in modernisierter Form.“ 72Es weiß um den „tiefen Riß, der durch die modernen Bewußtseine geht und der für alle Zeiten das Vernünftige und das Wirkliche, das, was man weiß, und das, was man tut, voneinander zu trennen scheint.“ 73„Handeln wider besseres Wissen ist das globale Überbauverhältnis heute; es weiß sich illusionslos und doch von der ‚Macht der Dinge‘ herabgezogen.“ 74
In Bezug auf die einstmals großen Hoffnungen und Weltgeschichtsphilosophien sind wir pessimistisch, ja: „Wir sind aufgeklärt, wir sind apathisch.“ 75„Unsere schwunglose Modernität weiß zwar durchaus ‚historisch zu denken‘, zweifelt aber längst daran, in einer sinnvollen Geschichte zu leben. ‚Kein Bedarf an Weltgeschichte.‘“ 76Die Aufgeklärten, das sind die „vom Gegebenen Erzogenen“ 77. Sie verbitten sich, „von geschichtlicher Erfahrung belehrt, billige Optimismen“ 78. Der Zyniker richtet sich ein im ‚wunschlosen Unglück‘ (P. Handke) 79; ihm gehört die Welt: „Nach den trotzigen Hoffnungen macht sich die Schwunglosigkeit der Egoismen breit.“ 80Im vollen Bewusstsein arbeitet der moderne Zyniker subjektiv an seiner Selbsterhaltung, objektiv an seinem Untergang. Er ist nicht mehr der ‚einzelgängerische Kauz‘, der ‚provozierende eigensinnige Moralist‘, der ‚bissige und böse Individualist‘ der Antike, sondern tritt „als Massentypus auf; ein durchschnittlicher Sozialcharakter im gehobenen Überbau“ 81; ein „Grenzfall-Melancholiker, der seine depressiven Symptome unter Kontrolle halten und einigermaßen arbeitstüchtig bleiben kann. Ja, hierauf kommt es beim modernen Zynismus wesentlich an: auf die Arbeitsfähigkeit seiner Träger – trotz allem, nach allem, erst recht. Dem diffusen Zynismus gehören längst die Schlüsselstellungen der Gesellschaft“ 82. Im umfassenden Sinne bedeutet der ‚universale diffuse Zynismus‘ 83als Daseinsweise: „Teilhabe an einer kollektiven realistisch herabgestimmten Sehweise.“ 84
Diese zu beschreiben, dazu dient die Kritik der zynischen Vernunft . Aber es soll auch nicht bei bloßer Beschreibung bleiben. Es mag nicht beim Eindruck bleiben, es handle sich bei ihr „um einen Rettungsversuch für ‚Aufklärung‘ und Kritische Theorie“ 85. Und doch: die bisher geschilderte Art des Zynismus soll auch nicht das letzte Wort sein. „Scheint es anfangs, als münde die Aufklärung notwendig in zynische Enttäuschung, so wendet sich bald das Blatt, und die Untersuchung des Zynismus wird zur Grundlegung guter Illusionslosigkeit.“ 86Sloterdijk möchte eine Bejahung versuchen, um – durchaus den Impulsen Kritischer Theorie verhaftet – „die Klammer des Negativismus zu sprengen.“ 87Es bedarf dazu einer anderen Wissenschaft, einer Fortsetzung von Aufklärung und Kritik mit anderen Mitteln, eines anderen Helden. Gerade die Selbstbesinnung der Aufklärung hatte den „Ausblick auf ein Leben in totaler Unaufklärbarkeit“ gegeben; gerade die großen Blicke der Theorie zeigten eine grundlegende Unübersichtlichkeit, ja mehr noch, mit einem Zitat aus späterer Zeit:
„Die Gegenwart hat uns Denkenden eine böse Entdeckung eingebracht; uns machen die großen Blicke überhaupt nicht froh, sie sind niederschmetternd. Unsere Aussicht aufs Ganze ergibt keinen Postkartengruß. Denken im 20. Jahrhundert heißt nicht, ein Kosmos-Ganzes anschauen, sondern eine Explosion mitdenken. […] Von Explosionen gibt es keine Theorie. Man kann Spurensicherung treiben“. 88
‚Theorie‘ scheint heute allenfalls zu bedeuten: Wissen, was sich nicht ändern lässt. 89Wo die Spannung „zwischen dem, was ‚kritisieren‘ will, und dem, was zu ‚kritisieren‘ wäre, […] so überzogen [ist], daß unser Denken hundertmal eher mürrisch als präzise wird“ 90, wo Aufklärung als ‚traurige Wissenschaft‘ „wider Willen die melancholische Erstarrung [fördert]“ 91, wo „der Ernst des falschen Lebens im falschen Ernst der Philosophie“ 92wiederkehre, da gelte es, „die kritische Sucht des Besserns auf[zu]lösen, dem Guten zuliebe“ 93. Das Ziel könne keine neue Theorie sein, die noch einmal besser wissen möchte, was sich besser machen ließe. Und ist es für Sloterdijk auch nicht. Dies hieße doch nur, auf einen Schelm anderthalb zu setzen. „Die Kritik der zynischen Vernunft verspricht sich darum mehr von einer Erheiterungsarbeit, bei welcher von Anfang an feststeht, daß sie nicht so sehr Arbeit ist als Entspannung von ihr. […] Ironischerweise ist das Ziel der kritischsten Anstrengung das unbefangenste Sichgehenlassen.“ 94Und nach dem Ende der großen Blicke vom Feldherrenhügel herab, wenn im Gewühl des Schlachtfelds „die Dinge uns brennend auf den Leib rücken, muß eine Kritik entstehen, die das Brennen zum Ausdruck bringt. Sie ist keine Sache richtiger Distanz, sondern richtiger Nähe.“ 95Diogenes von Sinope ist ihr Held.
Mit Diogenes begibt sich Sloterdijk auf die „Spur einer leibnahen untheoretischen Geistigkeit von dionysischem, jedoch nicht-tragischem Charakter.“ 96Der antike kynische Philosoph ist für ihn „der eigentliche Begründer der Fröhlichen Wissenschaft“ 97als der „höflichste[n] Art und Weise, öffentlich von den Unerträglichkeiten des Seins zu sprechen.“ 98Diogenes ist im Wortsinne die Verkörperung eines atheoretischen, frechfröhlichen Widerstands. Mit ihm bringt Sloterdijk in der Spur Heinrich Niehues-Pröbstings 99die Unterscheidung zwischen Zynismus und Kynismus ins Spiel, „die Differenz zwischen dem Zynismus als der Infamie des Mächtigen und dem Kynismus als der Noblesse des Machtlosen“ 100.
Diogenes’ „theoretische Hauptleistung besteht darin, die Wirklichkeit zu verteidigen gegen den Wahn der Theoretiker, sie hätten sie begriffen. […] Der Kyniker besitzt untrüglichen Instinkt für die Tatsachen, die nicht in die Großtheorien (Systeme) passen.“ 101Seine ‚Methode‘ ist das satirische Verfahren 102, die ironische „Aufhebung der aufgezwungenen ‚Ordnungen‘“, das „Spiel mit dem, was sich als ‚Gesetz‘ ausgibt“ 103. Die Satire offenbart „das von Adorno beschworene ‚Nicht-Identische‘; jenes Dies-da, an dem die bloße begriffliche Benennung schon Unrecht tut, indem sie Begreifen vortäuscht“ 104. Diogenes verkörpert, was nicht in die Theorie passt: nackte Wahrheiten, unbekleidet mit theoretischem Überhang. 105Er tritt für es ein, mit beißendem Spott, der das Brennen zum Ausdruck bringt, und mit Gesten, mit dem Körper als Argument, mit dem Körper als Waffe. 106Bissig, aber nicht verbissen ist dieser Diogenes. „Bei all seinen Kraßheiten ist Diogenes nicht oppositionell verkrampft und im Widerspruch fixiert“ 107. Denn Sloterdijks asiatisch-orientalisch imprägnierter 108Diogenes ist eben auch das Vorbild für ein heiteres Sichgehenlassen, das Sloterdijk gegen „die Neuzeit mit ihrem aktivistischen Selbstbehauptungsethos“ 109setzt, gegen deren „aktivistischen Sturmlauf des Selbermachens, Selberplanens und Selberdenkens“ 110. Diogenes’ vitaler, dionysisch-materialistischer, „kritische[r] Existentialismus des satirischen Bewußtseins“ 111steht für ein unambitioniertes Glück.
Читать дальше