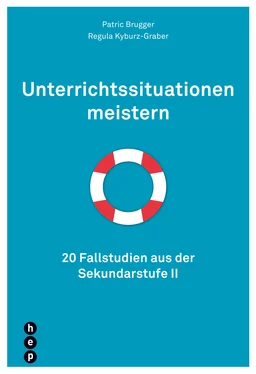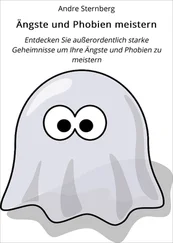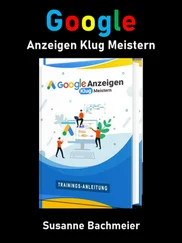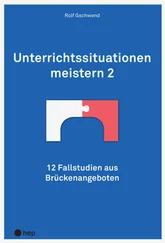Fallstudien als Forschungsmethodik haben eine längere Tradition in den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften und in der Soziologie. Ein Standardwerk zur Fallstudienforschung ist «Case Study Research: Design and Methods» des amerikanischen Sozialwissenschaftlers Robert K. Yin (2012, 2014). Die wohl berühmteste Fallstudie ist William F. Whytes jahrelange Untersuchung eines Chicagoer Viertels mit Bewohnern italienischer Herkunft, der sogenannten «Street Corner Society» (1955, 1996 auf Deutsch). Dem Autor ist es hier gelungen, in präziser, beschreibender, analytischer und interpretierender Weise die Besonderheit des Lebens in einem Quartier italienischer Migrantinnen und Migranten zu erfassen.
Durch Fallstudien wollen Forscherinnen und Forscher durch ein explorierendes Vorgehen zu beschreibenden und möglichst auch zu erklärenden Aussagen über den Untersuchungsgegenstand gelangen. Durch die Methode der dichten Beschreibung wird versucht, ein ganzheitliches Verständnis des Untersuchungsgegenstandes unter Einbezug von möglichst vielen als relevant erkannten Variablen zu erreichen. Der Analyse- und Interpretationsvorgang soll dabei jederzeit für Außenstehende nachvollziehbar und plausibel sein, vergleichbar einer Indizienkette in einem Gerichtsverfahren (Kyburz-Graber 2004, 2016).
Eine oft diskutierte Frage ist, ob sich die mit Fallstudien gewonnenen Erkenntnisse auf neue Fälle übertragen lassen. Mit einer oder mehreren Fallstudien lassen sich, zum Beispiel wie bei einem naturwissenschaftlichen Experiment, verallgemeinernde Hypothesen generieren, die sich durch weitere Fallstudien oder andere forschungsmethodische Vorgehensweisen überprüfen lassen. Die Hypothesen gelten so lange als wahr, als sie sich nicht falsifizieren lassen. Fallstudien dienen aber auch oft als sogenanntes Sozialreportage-Modell, d. h. sie stehen exemplarisch für vergleichbare soziale Situationen, ohne dass sie den Anspruch erheben, allgemein gültig zu sein. Yin (2013) spricht hier von analytischer, theoriegeleiteter Generalisierung im Vergleich zu statistischer Generalisierung.
Fallstudien als didaktische Methode
Fallstudien als didaktische Methode
Fallstudien als didaktische Methode haben ihren Ursprung in der Ausbildung von Studierenden der Rechtswissenschaften an der Harvard Graduate School of Business Administration. Die Ursprünge sollen bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen (Kaiser 1983, Kaiser und Kaminski 2011). Dabei wurden im Unterricht Gesetzmäßigkeiten am Beispiel von praktischen Gerichtssituationen induktiv vermittelt (Kasuistik, Harvard-Methode). Im Jahre 1985 folgte die Harvard Medical School der Fallstudientradition. Auch hier war die Überzeugung, dass ganz typische und repräsentative Beispiele aus der Praxis sich gut eignen, um Studentinnen und Studenten für die Praxis vorzubereiten.
In den Schulunterricht haben die Fallstudien als didaktische Methode erst später Eingang gefunden, zunächst vor allem im wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht (Weitz 2000). Fallstudienarbeit gehört zur sogenannten «Anchored instruction»-Didaktik und bildet eine mögliche Variante zur Umsetzung des situierten Lernens anhand authentischer Situationen. Schülerinnen und Schüler lernen an gut ausgewählten Fallsituationen grundlegende Denkfertigkeiten und -strategien, wie
–Probleme analysieren,
–Informationen sammeln, strukturieren, auswerten und diskutieren,
–Lösungsvarianten entwickeln,
–begründete Entscheidungen treffen und argumentativ vertreten.
Die Fallstudie wird deshalb auch als methodische Entscheidungsübung bezeichnet. Als Fall wird eine Situation aus dem Alltag oder Erfahrungshorizont der Lernenden gewählt. Das Material für die Bearbeitung eines Falles wird in der Regel möglichst umfassend angeboten, die Lösung wird offengelassen. Zum didaktischen Material gehören eine Situationsbeschreibung des Falles; Fakten, Meinungen, Ansichten zum Fall; Vorschlag zum Vorgehen; Erwartungen bezüglich Lösungen. Bei Varianten der Fallstudienmethodik müssen die Lernenden selbst zusätzliche Informationen recherchieren, oder Lösungen werden mit dem Material angeboten und die Lernenden haben die Aufgabe, diese kritisch zu beurteilen und eine begründete Entscheidung für eine Lösungsvariante zu treffen oder eine alternative Lösung zu entwickeln.
Fälle können eine Person (real oder als literarische Figur), eine Institution, ein politisches Ereignis, eine Entscheidungssituation einer Einzelperson oder einer Gruppe, ein öffentliches Projekt, ein Programm sein. Der Fall soll herausfordern und Interesse wecken. Wichtig ist, dass mit dem Material nicht nur Fakten zur Verfügung gestellt werden, sondern dass auch Wertkonflikte, unterschiedliche Meinungen, Hintergründe der Akteure usw. thematisiert werden. Wichtige Materialien sind zum Beispiel: Berichte, Stellungnahmen, Gutachten, Zeitungsartikel, Leserbriefe, Pläne, historische Dokumente, Bilder. Interessant an der Fallstudienarbeit ist die Auseinandersetzung mit der Komplexität der realen Situation. Eine didaktische Reduktion dieser Komplexität würde dem Prinzip der Konfrontation mit der Alltagsrealität zuwiderlaufen. Dies trifft auch für die gesuchten Lösungen zu: Es wird selten eindeutige Lösungen geben, die Lernenden haben Vor- und Nachteile abzuwägen und sich schließlich für eine Lösung zu entscheiden, im Bewusstsein darum, dass der aktuelle Wissensstand immer vorläufig und mit Fehleinschätzungen behaftet sein kann. Bei der Auswertung der Ergebnisse hat die Lehrperson die Aufgabe, grundsätzliche Kenntnisse, die mit der Fallbearbeitung erworben wurden, bewusst zu machen.
Beispiele für Fallstudien finden sich unter http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/und http://alt.sowi-online.de/methoden/dokumente/weitzfall.htm.
Fallstudien in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
Fallstudien in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
In der Aus- und Weiterbildung werden Fallstudien als didaktische Methode eingesetzt. In der konkreten Anwendung lehnen sie sich aber an die Fallstudien als Forschungsansatz an. Als didaktische Methode in der Bildung von Lehrpersonen werden sie von Bastian und Helsper (2000) so begründet:
Für die Förderung der individuellen Professionalität bedarf es der Stärkung zweier Wissenstypen: Neben dem bislang eindeutig dominierenden Fachwissen, dem bislang eher drittrangigen erziehungswissenschaftlichen Theoriewissen und dem sich zumeist unter beruflichen Sozialisations- und Initiationszwängen weitgehend naturwüchsig aufschichtenden methodischen und didaktischen Handlungs- und Erfahrungswissen bedürfen Lehrerinnen und Lehrer vor allem eines kasuistischen, reflexiven Fallwissens, das mit Theoriewissen vermittelt ist, sowie eines (berufs)biographisch selbstreflexiven, selbstbezüglichen Wissens. (Bastian und Helsper 2000, 182)
In der Fallbearbeitung sehen Bastian und Helsper die Möglichkeit, erfahrungsnahes Praxiswissen mit theoretischem Erklärungswissen zu verbinden. Auch in anderen grundlegenden Studien zur Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen wird die Fallarbeit als wichtige methodische Arbeitsweise benannt. So werden im Bericht «Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften», beruhend auf dem Bericht einer Arbeitsgruppe (Terhart et al. 2002, KMK 2004a), unter den didaktisch-methodischen Ansätzen für die Vermittlung bildungswissenschaftlicher Inhalte folgende als relevant erachteten Aspekte genannt: «Situationsansatz, Fallorientierung, Problemlösestrategien, Projektorganisation des Lernens, biographisch-reflexive Ansätze, Kontextorientierung, Phänomenorientierung» ([KMK] Kultusministerkonferenz 2004b). Im Beschluss von 2014 wurde die Liste ergänzt mit Praxisorientierung und Forschungsorientierung (KMK 2014). Situationsansatz, Fall- und Praxisorientierung, Problemlösestrategien, Kontextorientierung und Phänomenorientierung sind methodische Prinzipien, die alle in der Fallstudienarbeit zum Zuge kommen. In der Studie zu Standards in der Lehrerbildung postulieren Oser und Oelkers als optimale Verarbeitungstiefe von Ausbildungsinhalten eine systematische Verknüpfung von Wissen, Handeln und Reflektieren, indem die angehenden Lehrpersonen theoretisches Wissen erwerben, Übungen durchführen und Praxissituationen reflektieren (Oser 1997; Oser und Oelkers 2001). Eine solche Verknüpfung lässt sich unter anderem durch Fallstudienarbeit erreichen.
Читать дальше