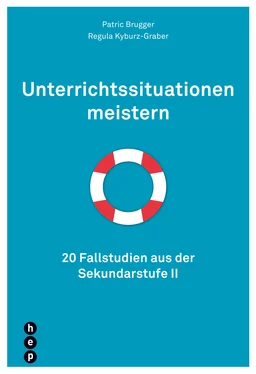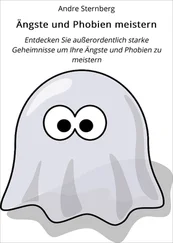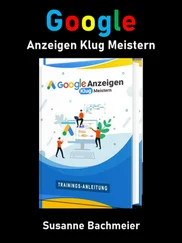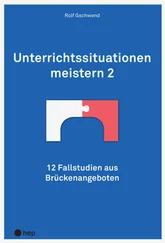Die vorgelegten Fallbeispiele stellen an alle Beteiligten hohe Ansprüche: Genau hinschauen, wie die Situation beschrieben ist, Auffälliges benennen, Besonderes herausheben, den ganzen Kontext der Situation verstehen und dann auf diesem Hintergrund die Fallsituation analysieren und schließlich Lösungsansätze suchen. Das ist mit jedem neuen Fallbeispiel eine neue Herausforderung.
Es ist nicht nur unser Ziel, Fallanalysen im Sinne von möglichst adäquaten Lösungsansätzen zu präsentieren. Auch für unsere Diplomkandidatinnen und -kandidaten ist dies nur ein Teilziel. Wir möchten mit den vorliegenden Fallanalysen Vorgehensweisen aufzeigen, die für eine umsichtige Lösungssuche zielführend sind. Natürlich hat man während des Unterrichtsgeschehens niemals Zeit, sich analytisch derart ausführlich mit der Situation zu befassen, wie wir das im vorliegenden Buch aufzeigen. Da gilt es eben meist, unter Druck rasch zu handeln. Aber je mehr man sich außerhalb des Unterrichts mit konkreten Fällen in genauen Analysen auseinandersetzt, desto flexibler und angemessener kann man in konkreten Situationen auch handeln.
Themenkreise der Fallbeispiele
Themenkreise der Fallbeispiele
Aus den Fallbeispielen, die wir im Laufe der Jahre zusammen mit den Studierenden analysiert haben, wählten wir für das vorliegende Buch solche Fälle aus, die wir im Blick auf die Praxis von möglichst vielen Lehrpersonen der Sekundarstufe II als besonders relevant erachten. Die Fallbeispiele stammen aus unterschiedlichen Unterrichtsfächern und Klassenstufen. Die ausgewählten 20 Fallbeispiele lassen sich den drei großen Themenkreisen Unterrichtsplanung und -durchführung, Klassenführung, Leistungsbeurteilung und Förderung zuordnen (Tabelle 2).
| Themenkreise |
Fallbeispiele |
| Unterrichtsplanung und -durchführung |
Heterogene Klassenzusammensetzung Mündliche Beteiligung Verweigerung von vertiefter Arbeit Trittbrettfahrer bei der Arbeit in Gruppen Fachliche Vorbereitung Klassenfeedback Konflikt mit Lehrplan |
| Klassenführung |
Den Unterricht sabotierendes Verhalten Eine impulsive Klasse oder das «Chaos» Kleider machen Schülerinnen Rivalitäten zwischen Jugendlichen Angespanntes Verhältnis Klasse – Klassenlehrperson Mögliche Rollenkonflikte Lehrperson – Privatperson |
| Leistungsbeurteilung und Förderung |
Benotung der mündlichen Beteiligung Benotung von Gruppenarbeiten Gestaltung und Korrektur einer schriftlichen Prüfung Notenpolitik der Schulleitung Nachprüfungen Betreuung einer Maturitätsarbeit Umgang mit Teilleistungsschwächen (z. B. ADHS) |
Tabelle 2Zuordnung der ausgewählten 20 Fallbeispiele zu drei Themenkreisen
Anregungen zum Studium der Fallbeispiele
Anregungen zum Studium der Fallbeispiele
Zunächst mögen die Titel, welche die Studierenden als Überschrift für ihr Fallbeispiel gewählt haben, zum Lesen einladen. Manche Titel erinnern an eigene Unterrichtssituationen; damalige Gefühle werden wieder wach, Lösungsvorschläge tauchen spontan auf. Vermutlich haben wir deshalb bei unseren Studierenden in jedem Kurs erlebt, dass manche so rasch wie möglich Lösungen finden und Ratschläge erteilen wollten. Mit diesem Rückgriff auf eigene Erfahrungen geht aber auch eine gewisse kritische Distanz verloren: Wir möchten mit unserer Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise zeigen, dass es sich lohnt, eine Fallsituation genau anzuschauen und der emotionalen Lage der Lehrperson, wie sie in der Schilderung dargestellt wird, nachzuspüren. Man muss in das Geschehen eintauchen können, natürlich immer unter der Optik der betreffenden Lehrperson.
Vielleicht ziehen Sie es als Leserin oder Leser vor, zunächst möglichst rasch in den Lösungen zu blättern. Mit der Zeit werden Sie aber zweifelslos mehr über Hintergründe und Erklärungen wissen wollen, oder Sie möchten nachvollziehen, wie man grundsätzlich an eine Fallanalyse herangeht. Dazu finden Sie bei jedem Fallbeispiel situationsbezogene Überlegungen.
Wenn Sie bei Ihrer Lehrtätigkeit in eine schwierige Situation geraten, so mögen Sie durch die Fallstudien angeregt werden, Ihre Situation für sich so zu beschreiben, wie es für die vorliegenden Fallbeispiele gemacht wurde, mit einem prägnanten Text und einem Titel. Dies kann ein erster Schritt sein, um Lösungen zu erarbeiten, allein oder mit Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie sich dann Zeit für die Problemanalyse nehmen und Schritt für Schritt vorgehen, wie wir dies mit den vorliegenden Fallstudien exemplarisch zeigen, werden sich schließlich Lösungsmöglichkeiten abzeichnen. Die nützlichen Erfahrungen, welche die angehenden Studierenden bei der Fallstudienarbeit machten, haben uns veranlasst, eine Auswahl von Fallstudien einem größeren Kreis von Lehrpersonen als Anregung zugänglich zu machen, wie sich herausfordernde Unterrichtssituationen bewältigen lassen.
Einführung in die Methodik der Fallstudie
Fallstudien werden grundsätzlich in zwei verschiedenen Zusammenhängen eingesetzt:
(1) Fallstudien als Forschungsmethodikim Rahmen der empirisch-qualitativen Sozialforschung: Hier dient die Fallstudie der Erforschung von komplexen sozialen Situationen, in denen Einzelpersonen oder Gruppen agieren.
(2) Fallstudien als didaktische Methodeim Rahmen von handlungs- und entscheidungsorientiertem Unterricht: Hier dient die Fallstudie der Auseinandersetzung mit einem realen Problem mit dem Ziel, dass die Lernenden Wissen und Fähigkeiten erwerben, um schließlich eine begründete Entscheidung in der Beurteilung des gestellten Problems zu treffen. Eine Variante dieser Form hat sich in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonenbewährt, indem Fallstudien als Werkzeug eingesetzt werden, um problematische Situationen im eigenen oder hospitierten Unterricht zu analysieren und Lösungen zur Verbesserung zu entwickeln. Dabei erweitern die Lehrpersonen ihr eigenes Fallwissen und bereiten sich auf das Handeln unter Druck (Wahl 1991, 2013) in zukünftigen Situationen vor.
Fallstudien in der Forschung
Fallstudien in der Forschung
Soziale Situationen, wie z. B. Unterricht, Krankenpflege, Beratung und Therapie, Change-Management-Situationen in Unternehmungen und Firmen, Familienhaushalte, Betriebe, sind hochkomplex und vielschichtig. Menschen mit ihren Erfahrungen, Einstellungen, Werthaltungen, früheren Erlebnissen, Entwicklungen und Ideen prägen die jeweiligen Situationen. Zusätzlich spielen die gegebenen gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen wie Wertvorstellungen, Normen, Gesetze und kulturelle Routinen eine handlungsrelevante Rolle. Den Beteiligten sind Hintergründe und Einschränkungen für das Denken und Handeln oft nicht bewusst. In Fallstudien lassen sich die komplexen Zusammenhänge Schicht für Schicht aufdecken und zur Erklärung und Lösung von Problemen heranziehen. Anders als mit einer distanziert-abstrahierenden Forschungsmethodik, wie sie zum Beispiel bei einer Fragebogenerhebung angewendet wird, ist das Ziel einer Fallstudie, so nahe wie möglich an das Geschehen heranzukommen. Fragebogendaten können zwar ebenfalls in eine Fallstudie einfließen, sie mögen die Sicht ergänzen. Aber für eine vertiefende Analyse braucht es andere Instrumente, wie etwa die Analyse von Dokumenten, Gespräche in Form von Interviews, Fokusinterviews, Erzählungen und moderierte Gruppengespräche. Weitere Methoden sind die teilnehmende Beobachtung und das «Shadowing», d. h. die Begleitung von einzelnen Personen über einen bestimmten Zeitraum (Stake 1995). In einer Fallstudie wird nicht nach dem «Wie viel» gefragt, sondern nach dem «Was» und «Wie» und schließlich auch nach dem «Warum» in der betreffenden Situation.
Читать дальше