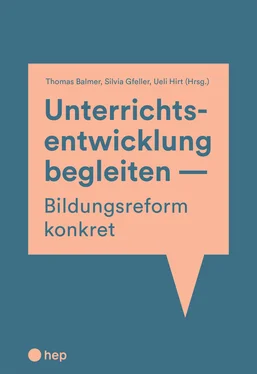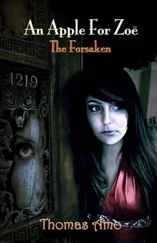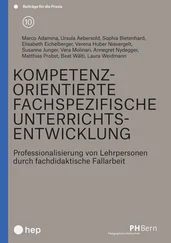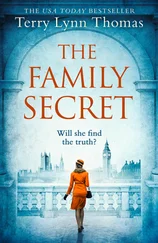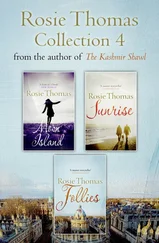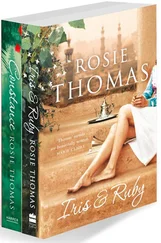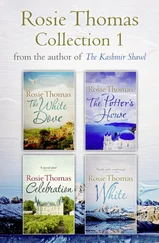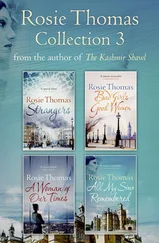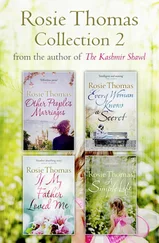1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Die Herausforderung für eine Reform besteht allgemein gesagt in der Realisierung einer pädagogischen Qualitätsentwicklung der einzelnen Schule (Oelkers & Reusser, 2008, S. 46ff.), der es gelingt, fokussiert Reformziele einzubinden. Von Vorteil ist es selbstverständlich, wenn die Ziele und Mittel durch das Bildungssystem als Ganzes unterstützt werden. Das ist eine Absage an eine Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung, die Lehrpersonen als gelegentliche Empfänger von Injektionen sieht, «to pep them up, calm them down, or ease their pain» (Hargreaves, 1994, S. 430) und entspricht eher, um Hargreaves Metapher zu gebrauchen, einer regelmässigen und ausbalancierten Diät (ebd.). Die Diät ist eingebunden in die alltäglichen Prozesse der schulischen Qualitätsentwicklung. Das alltägliche Essen verändert sich idealerweise nur in Bezug auf die Zubereitung und die Zutaten, nicht auch in Umfang und Dauer. Allerdings bedarf die neue Zubereitungsart unter Umständen auch eines Lernprozesses, der über die alltägliche Kochzeit hinausgeht: Unterrichtsentwicklung in einem breiten Sinn (siehe Kapitel 3 3 Unterrichtsentwicklung: Lernprozesse von Lehrpersonen Im Nachgang zum Begriff der Schulentwicklung hat sich der Begriff «Unterrichtsentwicklung» im Sinne der Verbesserung des Unterrichts etabliert. Auch dieser wird allerdings als wenig trennscharf (Oelkers & Reusser, 2008) kritisiert. Zudem kann der Begriff der «Entwicklung» eine biologische Vorstellung eines Prozesses nahelegen, der organisch und ohne explizite äussere Beeinflussung oder sogar aktive Steuerung vonstattengeht (Helmke, 2009). Unterrichtsentwicklung als Begriff aus der organisationstheoretischen Perspektive steht für Prozesse von Lehrpersonen, die als Lernprozesse zu sehen sind. In einem solchen engeren Sinn ist Unterrichtsentwicklung «die ureigenste Aufgabe jeder Fachperson, die unterrichtet» (Kyburz-Graber, 2004, S. 12) und ihre alltägliche Unterrichtsarbeit optimiert. Auch Unterrichtsentwicklung in einem breiteren Sinn, verstanden als eine «Intervention», sehen die Lehrpersonen selbst, vertreten durch ihren Dachverband, grundsätzlich als selbstverständlich an: Eine regelmässige Weiterbildung zur Erhaltung und Weiterentwicklung einer «wirksamen Berufsausübung» (LCH Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, 2008) ist wichtig. Das lässt sich auch daran ablesen, dass die Weiterbildung, wenn auch im Schatten der Grundausbildung, schon immer ein Thema im Zusammenhang mit Diskussionen um notwendige Veränderungen und Reformen der Schule war und vor allem auch von den Lehrpersonen selbst als solches eingebracht wurde (Balmer, 2018a). Lehrpersonen anerkennen auch die Notwendigkeit eines Weiterbildungsobligatoriums in spezifischen Fällen wie bei der Einführung von neuen Lehrplänen und Lehrmitteln (ebd., Landert, 1999).
) zur Reformimplementation braucht eine «Episode» (Quesel, 2019) der besonderen und fokussierten Anstrengung. Der Unterstützung durch die Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung durch Angebote beziehungsweise bestimmte Formen von Lerngelegenheiten fällt dabei eine bedeutende Funktion zu (Penuel et al., 2009).
5 Gestaltung von Lerngelegenheiten
Lernen ist kontextuell situiert und hoch individuell. Gerade angesichts von Reformen sind kognitiv-affektive Reaktionen eine bedeutsame Ausgangsgrösse für Lernprozesse und können sehr heterogen ausfallen. Ihre Bearbeitung braucht externe Expertise und Reflexion, deren Ergebnisse letztlich auch von organisationalen und schulkulturellen Umständen abhängen.
Aus den hier dargelegten Entwicklungen und der Forschung zur Wirksamkeit von Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung lassen sich verschiedene Aspekte ableiten, die für die Gestaltung eines Angebots zur Umsetzung eines Reformvorhabens wie der Umsetzung des Lehrplans 21 von Bedeutung sind, wenn bei den Lehrpersonen Lernprozesse ausgelöst werden sollen.
5.1 Nicht allein lernen – kollektives Lernen in der Schule
Wie in Kapitel 3 3 Unterrichtsentwicklung: Lernprozesse von Lehrpersonen Im Nachgang zum Begriff der Schulentwicklung hat sich der Begriff «Unterrichtsentwicklung» im Sinne der Verbesserung des Unterrichts etabliert. Auch dieser wird allerdings als wenig trennscharf (Oelkers & Reusser, 2008) kritisiert. Zudem kann der Begriff der «Entwicklung» eine biologische Vorstellung eines Prozesses nahelegen, der organisch und ohne explizite äussere Beeinflussung oder sogar aktive Steuerung vonstattengeht (Helmke, 2009). Unterrichtsentwicklung als Begriff aus der organisationstheoretischen Perspektive steht für Prozesse von Lehrpersonen, die als Lernprozesse zu sehen sind. In einem solchen engeren Sinn ist Unterrichtsentwicklung «die ureigenste Aufgabe jeder Fachperson, die unterrichtet» (Kyburz-Graber, 2004, S. 12) und ihre alltägliche Unterrichtsarbeit optimiert. Auch Unterrichtsentwicklung in einem breiteren Sinn, verstanden als eine «Intervention», sehen die Lehrpersonen selbst, vertreten durch ihren Dachverband, grundsätzlich als selbstverständlich an: Eine regelmässige Weiterbildung zur Erhaltung und Weiterentwicklung einer «wirksamen Berufsausübung» (LCH Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, 2008) ist wichtig. Das lässt sich auch daran ablesen, dass die Weiterbildung, wenn auch im Schatten der Grundausbildung, schon immer ein Thema im Zusammenhang mit Diskussionen um notwendige Veränderungen und Reformen der Schule war und vor allem auch von den Lehrpersonen selbst als solches eingebracht wurde (Balmer, 2018a). Lehrpersonen anerkennen auch die Notwendigkeit eines Weiterbildungsobligatoriums in spezifischen Fällen wie bei der Einführung von neuen Lehrplänen und Lehrmitteln (ebd., Landert, 1999).
und 4dargestellt, bedeutet wirksames Lernen von Lehrpersonen lerntheoretisch dynamische individuelle und kollektive Interaktionen der Person mit dem Unterrichten und dem Kontext ihrer Unterrichtspraxis. Dazu kommen die sozialanthropologischen (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998) und arbeitspsychologischen Hinweise auf die sozialen Bedingungen des Lernens und des Arbeitsplatzes Schule für die einzelnen Lehrpersonen, die auf Vorteile einer kooperativen schulinternen Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung schliessen lassen (empirische Evidenzen z.B. bei Camburn, 2010; Althauser, 2014). Die Forschung zeigt, dass die Kooperation der Lehrpersonen nicht nur ein Merkmal effektiver Schulen und eine fördernde Bedingung für die Übernahme und Umsetzung von Innovationen an Schulen darstellt (Gräsel, Fussangel & Parchmann, 2006; Fussangel & Gräsel, 2009; Steinert et al., 2006), sondern ebenfalls die langfristige Wirksamkeit von Weiterbildungsmassnahmen begünstigt (Freienberg, Parchmann, Pröbstel & Gräsel, 2008; Gersten, Dimino, Jayanthi, Kim & Santoro, 2010). Zudem kann der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen die Bewältigung berufsimmanenter Unsicherheiten, wie sie sich aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Unterrichts, der Komplexität des Berufsauftrags und reforminduziert ergeben, unterstützen (Soltau & Mienert, 2010).
Das wurde von der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung, deren Funktion die Unterstützung der Lehrpersonen ist, nicht immer so verstanden, auch weil die Entscheidungen darüber, welche Weiterbildungsziele verfolgt werden sollten, früher fast ausschliesslich bei den einzelnen Lehrpersonen lagen. Was und wie von Lehrpersonen gelernt werden soll, wurde lange als ein vollständig individueller, in der alleinigen Verantwortung der Lehrpersonen stehender Prozess angesehen (Huberman, 1995, S. 194). Für Grossbritannien beispielsweise stellt Bolam (2000) für den Zeitraum von 1960 bis Anfang 1980 fest, dass das vorherrschende Paradigma die individuellen Bedürfnisse einzelner Professioneller war. Selbst bei den aufkommenden schulinternen Weiterbildungen habe die Kontrolle trotz grösserer Beachtung der Bedürfnisse der Schulen und des weiteren Systems bei den Lehrpersonen gelegen. Das lässt sich auch für die Schweiz sagen, wie die Auseinandersetzung zwischen der Profession und dem Staat um die Institutionalisierung eines Weiterbildungsobligatoriums zeigt. Die Wahlfreiheit der Lehrpersonen bedeuteten der Profession viel (Balmer, 2018a; Kansteiner, 2015). In der Schweiz intensivierte sich die Diskussion um die Bedeutung der «Lehrerweiterbildung» in den 1960er-Jahren. Es gab erste Modelle eines systematischen Lehrplans für die Lehrerbildung von der Grundausbildung über den Berufseinstieg bis zur permanenten Weiterbildung während der Berufsausübung (Balmer, 2018a). Im Kanton Bern wurde die staatliche Förderung und Unterstützung erstmals 1966 im «Gesetz über die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen» festgeschrieben. Weiterbildung als auch im Umfang definiertes Recht und definierte Pflicht im Rahmen des Berufsauftrags wurde im Kanton Bern Anfang der 1990er-Jahre gesetzlich festgehalten. Darin findet sich auch die Feststellung, dass Lehrpersonen «zu Erneuerungsarbeiten im Gesamtrahmen der Schule [beitragen]» (Art. 17, Abs. 2, Grosser Rat des Kantons Bern, 1993).
Читать дальше