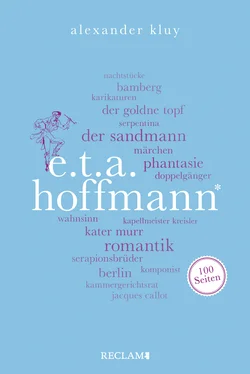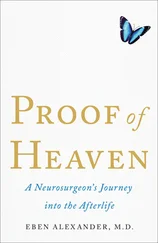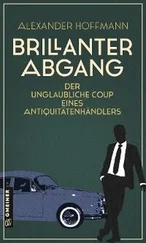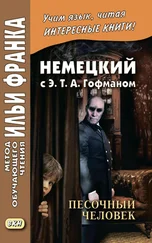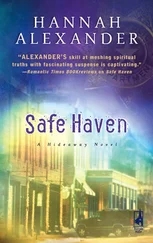»Mein Sinn für die Kunst ist hier so hors de saison , daß ich überall damit anstoße und mich verwunde. – Die Mahlerey habe ich ganz bey Seite geworfen, weil mich die Leidenschaft dafür, hinge ich ihr nur im mindesten nach, wie ein griechisches Feuer unauslöschlich von innen heraus verzehren könnte – […].«
Im Februar 1804 war die Zeit in diesem Nirgendwo beendet. Er wurde nach Warschau versetzt, als Regierungsrat der Südpreußischen Regierung. Wichtig wurde ein neuer Freund, der aus wohlhabender jüdischer Familie stammende Berliner und Jurist Julius Eduard Itzig (1780–1849); 1808 setzte er seinem Familiennamen ein »H« voran und nannte sich seither »Hitzig«. Noch wichtiger von nun an für Hoffmann: Er selbst tauschte seinen dritten Vornamen »Wilhelm« aus für – Verbeugung vor dem verehrten Mozart –»Amadeus«. Im Juli 1805 wurde Hoffmanns einziges Kind, die Tochter Caecilia, geboren, benannt nach der Schutzheiligen der Musik, sie sollte mit zwei Jahren sterben. Da war Hoffmann arbeitslos – die Truppen Napoleons hatten Preußen zum Einsturz gebracht, der König war nach Memel geflohen. Die Beamten der Justiz mussten einen Eid auf den neuen Machthaber ablegen. Hoffmann, obschon lebenslang desinteressiert an Politik, verweigerte sich wie viele andere auch. Und wie viele andere auch wurde er deshalb aus dem Justizdienst verstoßen.
Es gab nur noch Warten. Und dann kam noch Hunger dazu. Und Krankheit. Er war in einem Kämmerchen unterm Dach der Musikalischen Gesellschaft untergekommen, Mischa und Caecilia hatten Zuflucht bei Verwandten in Posen gefunden. Hoffmann erkrankte schwer an Typhus, wurde von Freunden gepflegt, die immer weniger wurden, weil es sie alle nach Berlin zog. Eigentlich wollte er selbst nach Wien, dafür fehlten ihm aber Geld und Visum. Also auch ab nach Berlin. Am 18. Juni 1807 kam er an, Freund Hitzig hatte umgesattelt von Jura auf Buchhandel. Die Stadt, besetzt von den Franzosen, wimmelte von stellungslos gewordenen Beamten. Hoffmann hungerte, wurde wieder krank, niemand wollte – das Spielbein war nun einziges Standbein – seine Kompositionen, keiner Zeichnungen von ihm veröffentlichen. Anfang 1808 gab er eine Annonce auf: »Musikdirektor sucht Compagnie«. Eine Antwort traf ein – aus Bamberg, von Julius Graf von Soden, der ihm einen Posten antrug. Soden, 1754 geboren, entstammte einer alten Hannoverschen Patrizierfamilie, war fürstlich brandenburgischer Regierungsrat gewesen, Geheimrat, preußischer Gesandter beim Fränkischen Reichskreis zu Nürnberg. Seit 1796 Privatier, lebte er auf Gut Sassanfahrt, heute zu Hirschaid im Landkreis Bamberg gehörend, an der Regnitz und stand seit 1804 als Liebhaber der Künste – er schrieb mit rascher Hand und in sorglos schneller Folge Dramen, Erzählungen, historische, philosophische und religiöse Werke und übersetzte Cervantes – dem Bamberger Theater vor. Er hatte ein großes Stadthaus gekauft, dieses zur Bühne umbauen lassen, selbst Theaterstücke inszeniert, etwa Mozarts Opern Don Giovanni und Die Zauberflöte . Die aber durchfielen. Das Publikum wollte Unterhaltung. Sodens Säckel strapazierte das Unternehmen bald allzu stark. Das Haus veräußerte er an eine Gastwirtin, die darin eine Wirtschaft betrieb, er reservierte sich aber das Anrecht auf Aufführungen im Bühnenraum.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.