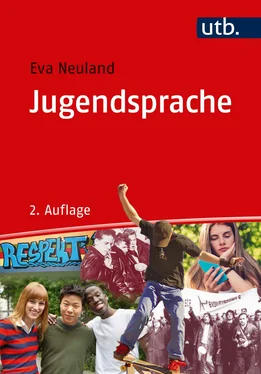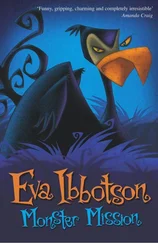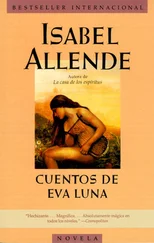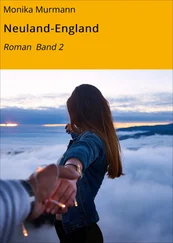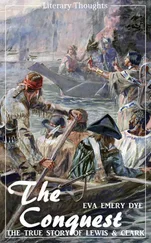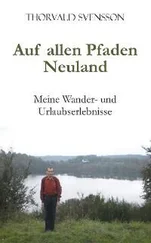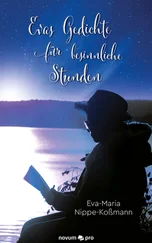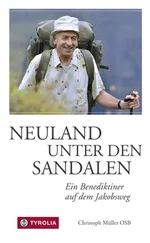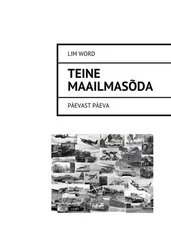Angesagt: Scene-Deutsch. Ein WörterbuchWörterbücher (Rittendorf u.a. 1984). In den 90er Jahren folgen u.a.:
Affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache (EhmannEhmann, Hermann 1992)
Oberaffengeil. Neues Lexikon der Jugendsprache (EhmannEhmann, Hermann 1996)
Duden. Wörterbuch der Szenensprache (2000)
Voll konkret. Das neueste Lexikon der Jugendsprache (EhmannEhmann, Hermann 2001)
Leet & leiwand: das Lexikon der Jugendsprache (Sedlaczek 2006).
Bei diesem Markt der WörterbücherWörterbücher handelt es sich um Publikationen ohne wissenschaftlichen Anspruch, aber auch ohne wissenschaftlich gesicherte Aussagekraft, was die Auswahl der Lexeme und die Bedeutungszuschreibungen betrifft. Dieser Typ von Publikationen trägt entschieden zur Vermarktung von „Jugendsprache“ bei, und zwar durchaus profitabel für die Produzenten: Der Trend hält bis in die heutige Zeit an, z. T. mit immer aufwändigeren Publikationen wie das Techno-Lexikon (1998) oder das Graffiti-Lexikon (1998).1
Den bisherigen Höhepunkt stellt aber zweifellos das DUDEN-Wörterbuch der Szenesprachen aus dem Jahr 2000 dar, das sich in Inhalt und Aufmachung in die Tradition der populärwissenschaftlichen WörterbücherWörterbücher der Jugend- und Szenesprachen einreiht. Herausgegeben ist diese Publikation von einem „Trendbüro in Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion“. Ein Großteil der verzeichneten Ausdrücke scheinen Augenblicksbildungen, Einzelfallbeispiele oder schlicht Erfindungen der Autoren, was durch befragte Jugendliche bestätigt wird, denen viele der aufgeführten Ausdrücke unbekannt sind. Jugendliche durchschauen diese Vermarktungsstrategie sehr wohl, wie die folgende Äußerung belegt:
„Es gibt Leute, die glauben, Szenesprache müsse man nur nachplappern, um ‚cool‘ zu sein und an die jugendliche Zielgruppe ranzukommen – als Lehrer, Sozialarbeiter oder Werbe-Mensch. Solche Leute haben in ihrer Jugend noch ‚megaaffengeil‘ gesagt, und man nennt sie Poser (…), denn die Poser, die dieses Nachschlagewerk vor allem benutzen werden, wollen ja nur bei passender Gelegenheit die eine oder andere auswendig gelernte Vokabel in den Raum schmeißen.“
(Kommentar einer Jugendlichen zum Duden-Wörterbuch der Szenesprachen im Remscheider Generalanzeiger vom 03.05.2000, S. 20)2Neuland, Eva
Seit 2008 hat der Langenscheidt-Verlag die Aktion: Jugendwort des Jahres Jugendwort des Jahres ins Leben gerufen. Per Internet werden Vorschläge gesammelt, letztlich entscheidet eine Jury unüberprüfbar nach Ermessenskriterien. 2008 landete der Ausdruck: Gammelfleischparty auf dem ersten Platz, in den letzten Jahren lauteten die Sieger: Yolo, Babo, Läuft bei dir?, Smombie, fly sein. I bims wurde als Jugendwort des Jahres 2017 angegeben. Die vermeintlichen Vorzüge dieses Verfahrens, u.a. freie Zuschriften über das Internet, transparenter Auswahlprozess, erwiesen sich jedoch als geschickte Marketing-Strategie für die jährlich erscheinende Langenscheidt-Broschüre: 100 Prozent Jugendsprache. Das Buch zum Jugendwort des Jahres. In die engere Wahl genommene Ausdrücke wie: hartzen und guttenbergen , aber auch Komposita wie: Gammelfleischparty , Niveaulimbo und Arschfax scheinen eher Konstruktionen aus der Feder professioneller „Trendbüros“. Die reklamierte Authentizität ist angesichts der Anonymität der Zuschriften und in Ermangelung von Gebrauchserhebungen zurückzuweisen. Jugendsprache als Konsumgut bleibt anscheinend aktuell.
Als Jugendwort des Jahres wurde 2017 die Formulierung I bims aus der sog. „Vongsprache“ ausgegeben3. Für einen peinlichen Öffentlichkeitsauftritt sorgte der Autohersteller Mercedes-Benz im Sommer 2017 mit dem Werbeslogan „I bims fancy S-Klasse“ für eine Luxuslimousine im Wert von fast 85.000.- Euro. Die öffentlichen Reaktionen reichten von Verwirrung bis zu einem Shitstorm in den sozialen Medien.
Indessen hat sich der Werbetrend mit konstruierten Beispielen der „Vongsprache“ fortgesetzt (u.a. bei Vodaphone und der Sparkasse) und selbst vor dem DUDEN nicht haltgemacht (Slogan: „Man muss immer auf korrekte Rechtschreibung 8en. Vong Grammatik her.“).
Inzwischen wurden eine Holyge Bimbel . Storys vong Gott u s1 crew sowie eine Faust-Ausgabe herausgebracht ( I bims Faust ) und die Formel: I bims x vong y her hat den Status eines geflügelten Wortes eingenommen – aber eben nur als Werbeslogan.
2.3 Brennpunkte der aktuellen SprachkritikSprachkritik
Die Brennpunkte der aktuellen SprachkritikSprachkritik sind wiederum zeitdiagnostisch aufschlussreich im Hinblick auf die Analyse von heute vorherrschenden Vorstellungen von Sprachgebrauch und Sozialverhalten. Jugendliche und ihre Eltern unterscheiden sich heute – im Unterschied zu der „skeptischen“ und der „antiautoritären“ Nachkriegsgeneration – kaum mehr in Kleidung, Freizeitvorlieben und Lebensstil, und auch der Sprachstil von Erwachsenen ist heute informeller als früher geworden. Im Unterschied zu der Großelterngeneration sind die meisten Eltern heute nicht mehr so schockiert über „unanständige Ausdrücke“ wie frühere Generationen. Im Zuge sozialer und kultureller Entgrenzungen sind Grenzüberschreitungen, auch verbale, heute zumindest seltener als früher geworden.
Dennoch bleiben im medialen Diskurs hauptsächlich die folgenden 4 Brennpunkte der aktuellen Kritik am Sprachgebrauch von Jugendlichen.1
Jugendsprache als FäkalspracheFäkalspracheDer Vorwurf der „unanständigen“ Ausdrücke von Jugendlichen wurde schon in früheren Phasen der Sprachgeschichte erhoben. Und auch aktuell erregen Fäkal- und Sexualausdrücke (z.B. fick dich, Wichser ) öffentliche Missbilligungen. Ob solche Ausdrücke tatsächlich von Jugendlichen häufiger als von Erwachsenen verwendet werden, ist wissenschaftlich nicht belegt. Vielmehr hat die Jugendsprachforschung inzwischen nachgewiesen, dass solche Ausdrucksweisen in der intragruppalen Jugendkommunikation überwiegend nicht in beleidigender provozierender, vielmehr oft auch in scherzhafter Absicht verwendet werden.2 In jugendtypischer Hinsicht werden die Bedeutungen gegenüber der Standardsprache oft erweitert, wie das Beispiel des Ausdrucks geil als positive Wertungsbezeichnung zeigt.
Jugendsprache als ComicspracheComicspracheEs ist ein weitverbreitetes Vorurteil, dass Jugendliche sich nur noch in einer Art „,LallwörterLallwörter“-Kommunikation ausdrücken, keine Grammatik mehr beherrschen und kein SprachgefühlSprachgefühl mehr besitzen würden. Die moderne Variante dieser These bezieht sich auf den medientypischen Sprachgebrauch des sog. „Simsens“ und „Chattens“ mit seinen AbkürzungenAbkürzungen (z.B. cu für see you , lol für laughing out loud ), InflektivkonstruktionenInflektivkonstruktion ( grins, heul, freu ) und nicht normgerechten Schreibweisen ( froi, 4u ) und führt zu der Befürchtung, dass sich ein solcher Sprachgebrauch allgemein bei Jugendlichen einbürgern könne. Abgesehen davon, dass der witzige Effekt gerade den medialen Kontext voraussetzt, findet diese Befürchtung keine wissenschaftliche Bestätigung.3Dürscheid, Christa
Jugendsprache als DenglischDie öffentliche Kritik an einem Übermaß an EntlehnungenEntlehnungen aus Fremdsprachen ist ebenfalls aus der Sprachgeschichte bekannt. Im 18. Jahrhundert nahm es die Form einer Kritik an Entlehnungen aus dem Französischen an. Damals lautete der Vorwurf „Petitmätereipetits maîtres, Petitmäterei“.4 Heute wird, vor allem in der medialen Berichterstattung, die Furcht vor „ Denglisch “„Denglisch“, einer deutsch-englischen SprachmischungSprachmischung, geschürt, die als Hauptursache eines vermeintlichen „SprachverfallsSprachverfall“ des Deutschen angesehen wird. So lamentiert die Zeitung „Sprachnachrichten“ des Vereins für deutsche Sprache:
Читать дальше