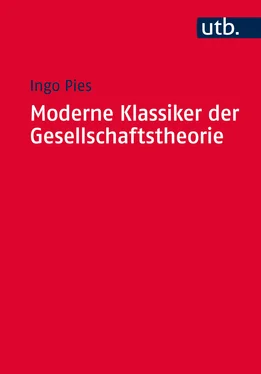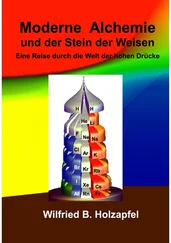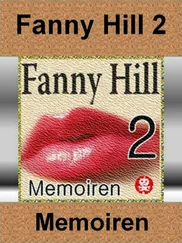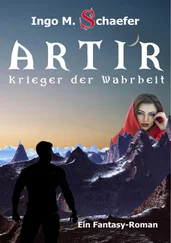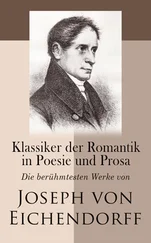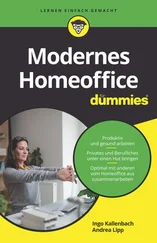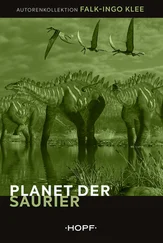Ingo Pies - Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie
Здесь есть возможность читать онлайн «Ingo Pies - Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ingo Pies versammelt in diesem Buch 20 Texte, die jeweils das Denken eines modernen Gesellschaftstheoretikers vorstellen. Er bietet eine Einführung in das Gesamtwerk des Denkers sowie eine systematische und historische Einordnung.
Das Werk eignet sich für Forschung und Lehre: als Inspiration für die eigene theoretische Arbeit, als Nachschlagewerk sowie als Seminargrundlage.
Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mit diesen drei Bedingungen gewährt eine wohlgeordnete Gesellschaft ihren Bürgern Autonomie im emphatischen Sinn – Rawls (1992; S. 88) spricht von „vollständiger Autonomie“: Voll autonome Bürger sind in mehrerlei Hinsicht frei. Zum einen hängt ihre Identität nicht an einer besonderen Konzeption des Guten. Sie bleiben sie selbst, auch wenn sie am System ihrer letzten Ziele Revisionen vornehmen. Der Bürger einer wohlgeordneten Gesellschaft ist frei zu lernen und in diesem Sinn unabhängig von den einzelnen besonderen Anschauungen, die er sich im Laufe solcher Lernprozesse jeweils zu eigen macht. Zum anderen sind die Bürger berechtigt, Anforderungen an das gesellschaftliche Institutionensystem zu stellen. Sie dürfen fordern, dieses solle sich an ihren Interessen orientieren, und dieser Anspruch kommt ihnen als Person, d.h. als kooperationsfähiger Bürger, zu. Es ist ihr Recht, institutionelle Strukturen – bzw. Reformen dieser Strukturen – einzufordern, die ihrem Gerechtigkeitssinn entsprechen und die sozialen Bedingungen, d.h. die Mittel bereitstellen, die sie in |8|die Lage versetzen, ihre Konzeption des Guten, d.h. ihr System letzter Ziele, zu verwirklichen.[7] Zusammengenommen findet die Freiheit vollautonomer Bürger somit darin ihre Realisation, dass diese dem gesellschaftlichen Institutionensystem im Bewusstsein ihrer Personalität innerlich zustimmen können. Bei diesem Gerechtigkeitskonzept handelt es sich folglich um eine Reformulierung des insbesondere von Friedrich August von Hayek reaktualisierten liberalen Ideals der Freiheit unter dem Gesetz, bei dem Institutionen nicht als Einschränkung, sondern als Ermöglichung und Erweiterung von Freiheit gedacht werden. In der neueren Terminologie von John Rawls lässt sich dieser zentrale Gedanke auch so formulieren: In einer wohlgeordneten Gesellschaft können die Bürger das Vernünftige rational einlösen.[8] Ihre Anreize sind institutionell so gesetzt, dass sie (der Selbstverständlichkeit) sozialer Kooperation und damit individueller Freiheit – nicht von , sondern – in der Gesellschaft förderlich sind.[9]
(2) Im Urzustand werden die beiden Kategorien des Vernünftigen und des Rationalen systematisch unterschieden und erst auf der Basis dieser Unterscheidung systematisch zusammengeführt: Das Rationale wird in den Parteien verortet, die als künstliche Akteure der Homo-oeconomicus-Konstruktion nicht unähnlich sind; das Vernünftige geht in den Urzustand ein in Form jener – mit Hilfe der Figur eines Schleiers operationalisierten – Bedingungen, die Fairness gewährleisten sollen und hierin in gewisser Weise den Restriktionen eines ökonomischen Modells entsprechen, indem sie den Akt rationaler Entscheidungsfindung in eine bestimmte Bahn lenken. Ganz in diesem Sinne formuliert Rawls (1992; S. 100) mit Blick auf den Urzustand: „Das Vernünftige ist dem Rationalen übergeordnet, |9|denn seine Grundsätze begrenzen … die letzten Ziele, die verfolgt werden können.“[10]
Für ein angemessenes Verständnis des Urzustands und seiner Konstruktion ist es unabdingbar, sich zu vergegenwärtigen, dass es sich hier im Gegensatz zum Modell einer wohlgeordneten Gesellschaft nicht um ein Ideal, sondern um ein Darstellungsmittel handelt. Als solches hat es eine klar umrissene Aufgabe: Es dient dazu, eine Verbindung herzustellen zwischen dem Begriff einer moralischen Person und den Gerechtigkeitsgrundsätzen, und zwar so herzustellen, dass diese Verbindung den Bürgern einer wohlgeordneten Gesellschaft – also einem fiktiven Publikum! – als guter Grund zur Rechtfertigung der Gerechtigkeitsgrundsätze erscheinen kann. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, müssen im Urzustand angemessen repräsentiert sein: erstens die beiden Vermögen, die das Kennzeichen moralischer Personalität sind; zweitens die Öffentlichkeitsbedingungen einer wohlgeordneten Gesellschaft, die den Bürgern vollständige Autonomie verbürgen; und schließlich drittens jene Fairness, die sicherstellt, dass mit Hilfe der Verfahrensgerechtigkeit gerechte Grundsätze abgeleitet werden.
Erstens: Die beiden Vermögen moralischer Personalität sind im Urzustand rein formal repräsentiert (Rawls, 1992; S. 124f.): Der Gerechtigkeitssinn der Parteien ist inhaltlich unbestimmt. Sie kennen die Gerechtigkeitsgrundsätze noch nicht, auf die sie sich im Verlauf des Verfahrens ja erst noch einigen müssen. Auch ist den Parteien unbekannt, welche Konzeption des Guten sie jeweils verfolgen. Sie kennen nicht ihre letzten Ziele. Diese sind für sie hinter dem Schleier des Nichtwissens verborgen, so dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als allgemein über jene Mittel nachzudenken, die zweckmäßigerweise jedem Gesellschaftsmitglied eingeräumt werden sollten, damit es seine (ihm noch unbekannten) letzten Ziele trotzdem möglichst wirksam verfolgen kann.
Zweitens: Von den drei Öffentlichkeitsbedingungen, die eine wohlgeordnete Gesellschaft kennzeichnen, sind naturgemäß nur die ersten beiden im Urzustand repräsentiert (Rawls, 1993; S. 70f.): Von den Parteien wird verlangt, dass sie sich (nur) auf solche Gerechtigkeitsgrundsätze einigen, die das Institutionensystem wirksam regulieren können und sich mit Hilfe allgemein geteilter Überzeugungen überprüfen lassen. In den Worten von Rawls (1992; S. 114): „Grundsätze, die recht gut funktionieren könnten, vorausgesetzt, sie würden nicht öffentlich anerkannt (wie auf der ersten Stufe definiert), oder vorausgesetzt, die allgemeinen Überzeugungen, auf die sie gegründet sind, würden nicht öffentlich verstanden oder als fehlerhaft angesehen (wie auf der zweiten Stufe definiert), müssen zurückgewiesen werden.“ – Auch die drei Freiheitsmomente vollständiger Autonomie finden sich im Urzustand repräsentiert: Zum einen gibt es für die Parteien keinerlei externe Maßstäbe, keinerlei Vorgaben, sondern nur den einen internen Maßstab, dass sie selbst es sind, die die Regeln ihres Zusammenlebens und die zugrundeliegenden Gerechtigkeitsvorstellungen festlegen. Ihre Bindungen sind Selbst-Bindungen. Rawls (1992; S. 125) fasst diesen Umstand |10|begrifflich als „rationale Autonomie“[11]. Sie repräsentiert Freiheit als Quelle von Ansprüchen. Freiheit als Unabhängigkeit kommt im Urzustand darin zum Ausdruck – so Rawls (1992; S. 126) –, „wie die Parteien dazu bewegt werden, der Sicherung der sozialen Bedingungen zur Verwirklichung ihrer höchstrangigen Interessen einen Vorrang einzuräumen, und dadurch, dass sie, trotz der strengen Informationsbeschränkungen, die der Schleier der Unwissenheit mit sich bringt, Gründe haben übereinzustimmen“. Eine solche Übereinstimmung bezieht sich auf jene Mittel, die eine gerechte Gesellschaft jedem Bürger zur Verfügung stellen sollte, und sie wird von den Parteien mit Hilfe eines Verzeichnisses der für die Konzeptionen des Guten benötigten Grundgüter herbeigeführt. Grundgüter sind die operationalisierbaren Mittel für die Verwirklichung der Systeme letzter Ziele. Dass man sich auf Mittel einigen kann, ohne die Ziele zu kennen, die für die Parteien hinter dem Schleier des Nichtwissens verborgen sind, zeigt die Unabhängigkeit von der jeweiligen Konzeption des Guten und ist hierin Ausdruck von Freiheit. Das dritte Element bürgerlicher Autonomie, Freiheit als Verantwortung, ist im Urzustand dadurch repräsentiert, dass dem Vernünftigen ein Vorrang vor dem Rationalen eingeräumt wird: Die mit Hilfe des Schleiers spezifizierten vernünftigen Bedingungen geben der individuell rationalen Entscheidung einen Rahmen vor, der die Parteien von vornherein nur solche Konzeptionen des Guten in Betracht ziehen lässt, die mit Gerechtigkeitsgrundsätzen vereinbar sind. Diese Verpflichtung des Rationalen auf das Vernünftige spiegelt jene Verantwortung wider, in der sich für Rawls die Freiheit moralischer Personalität ausdrückt: die Verantwortung, dass die individuellen Ziele den sozial verfügbaren Mitteln angemessen sind.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Moderne Klassiker der Gesellschaftstheorie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.