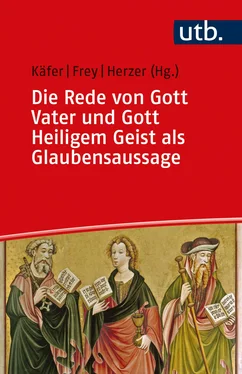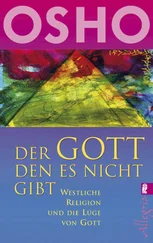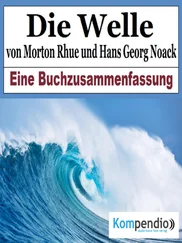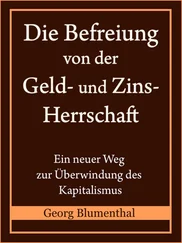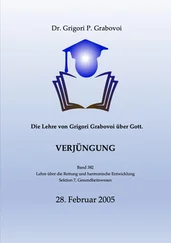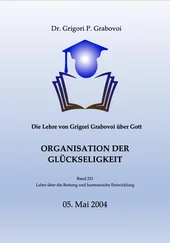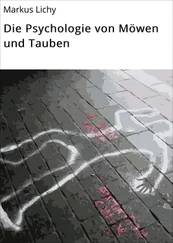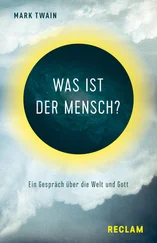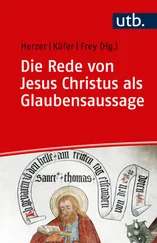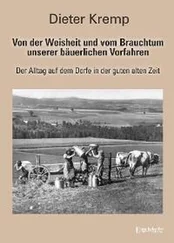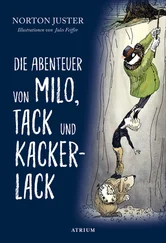Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage
Здесь есть возможность читать онлайн «Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Als zweiten Akkord des Auftaktes schlägt Reinhard Achenbach unter dem Titel »Gottesverehrung und Gottesbekenntnisse im |6|religionsgeschichtlichen Horizont« einen weiten und beeindruckenden Bogen in die Religionsgeschichte des Alten Orients. Er führt damit bereits in jenen Kontext hinein, der für den ersten Artikel über den Vater- und Schöpfergott von Bedeutung ist. Insbesondere Schöpfungsmythen erweisen sich in altorientalischen Texten als Bestandteile weisheitlicher Lehre durch »Erzählungen, die die Wirklichkeit erschließen, und die in einer für den Menschen transzendenten Erschlossenheit des Wirklichkeitsbezugs ihren Ursprung erkennen« (60) lassen. Der Gottesbegriff wird in diesen Erzählungen in seiner Bedeutung für die Erschließung von Wirklichkeit konkret in der Verehrung Gottes zur Geltung gebracht, die zugleich das Gottes bekenntnis einschließt und damit gemeinschaftsstiftende Kraft entfaltet. Exemplarisch wird dies anhand der Debatten um die Ursprünge des Jahwismus gezeigt, wobei Achenbach hervorhebt, dass bereits im Pentateuch selbst eine bemerkenswerte und komplexe Theorie über die »Geschichte der Gotteserkenntnis Israels (als) Teil einer universalen Erkenntnisgeschichte« (72) entwickelt wird.
Die Auslegung des ersten Artikels eröffnet Christiane Zimmermann mit einem Beitrag über die Vater-Metaphorik als Ausdruck des Wesens Gottes. Sie zeichnet darin die biblischen Linien bis zu den apostolischen Vätern nach und legt dabei großen Wert auf die Tatsache, dass die christliche Vateranrede tief in der alttestamentlich-jüdischen Tradition verankert ist. Für die christliche Adaption sei wesentlich »die Verbindung von ekklesiologischer und christologisch-hoheitlicher Referenz der Vaterschaft Gottes« (96). Die Sohnschaft Christi korreliert mit der Kindschaft der Glaubenden, bezogen auf denselben Vater. Zugleich geht dies einher mit einer »kreatorisch-kosmologischen Referenz der Vater-Metapher« (99). Dadurch werde nicht zuletzt deutlich, warum im Apostolikum die Vateranrede an den Anfang gestellt wird. Aus systematisch-theologischer Perspektive beschreibt und erörtert Malte Krüger in Anknüpfung an den englischen Begriff des »Godfather« aus dem gleichnamigen Film von Francis F. Coppola die multiperspektivische Krise des religiösen Vaterbildes als Beispiel für die Notwendigkeit eines programmatischen Neuansatzes evangelischer Theologie. Insofern Religion »im menschlichen Bildvermögen und seiner Einbildungskraft fundiert« (125) sei und also als eine Projektion des Menschen zu gelten habe, stehen die Begriffe Imagination und Phantasie für eine neue »bildhermeneutische Theologie«, die kulturanthropologisch zu begründen sei (133).
|7|Das Attribut der Allmacht Gottes erschließt Markus Witte aus alttestamentlicher Sicht mit einem spezifischen Blick auf das Judentum der hellenistischen Zeit. Dessen theologische Perspektiven insbesondere auf das Wesen Gottes angesichts einschlägiger Krisenerfahrungen sind auch für das Neue Testament außerordentlich bedeutsam geworden. Dabei spielen Fragen nach der Herrschaft Gottes, seiner Gerechtigkeit und Güte eine besondere Rolle, insofern sich darin seine Allmacht in einer sehr konkreten Weise für den Glauben manifestiert. »Der Glaube an den Allmächtigen«, so die abschließende These, »ist Ausdruck eines monotheistischen, dynamischen und personalen und partizipatorischen Gottesverständnisses« (172). Die systematisch-theologische Herausforderung durch die Frage nach der Allmacht Gottes ist für Michael Moxter maßgeblich von politischer Natur: »Pointiert das Bekenntnis zu Gott dem Schöpfer die Einzigkeit seiner Herrschaft, so kann es zur Kritik bestimmter Herrschaftsformen ermuntern und eine Art Sperrklinkeneffekt für imperiale Selbstinszenierungen auslösen« (180). Zugleich müsse man sich aber auch der Gefahr eines solchen Gottesbildes, das von einer potentia absoluta bestimmt werde, bewusst sein. Es komme daher darauf an, wie bzw. wovon der Begriff von Macht verstanden wird.
Mit dem schöpfungstheologischen Aspekt des ersten Artikels beschäftigen sich Lutz Doering und Christopher Zarnow. Lutz Doering kommt es in seiner detailreichen Studie insbesondere darauf an, das Bekenntnis zu Gott als Schöpfer anhand neutestamentlicher Schöpfungsaussagen im Kontext der alttestamentlich-jüdischen Tradition zu verstehen und »die kosmologischen, heilsgeschichtlichen, identitätspolitisch-sozialen, ethischen, christologischen und eschatologischen Implikationen des Bekenntnisses vor Augen« zu stellen (237). Christopher Zarnow geht von der Beobachtung aus, es genüge »nicht mehr, die Aufgabe der systematischen Theologie als kritische Reflexion positiv irgendwie gegebener Glaubensbestände zu bestimmen«. Vielmehr sei von der Dogmatik regelrecht »Aufbauarbeit am Symbol zu leisten«, um noch zeitgemäß sagen zu können, was es bedeutet (239). So schreitet Zarnow buchstäblich einen weiten und spannend beschriebenen Horizont ab, der von einer Bestandsaufnahme des »blauen Planeten« Erde in den Himmel und von dort mit neuen Perspektiven zurück zur Welt als Schöpfung und damit zur Erschließung des Symbolgehalts des Bekenntnisses zu Gott als Schöpfer Himmels und der Erden führt, der zugleich der das Geschöpf » persönlich angehende[.] Gott« ist (264).
|8|Auch der dritte Artikel des Apostolikums birgt seine eigenen Herausforderungen. Dass damit, wie der Untertitel des dritten Hauptteils aussagt, im Kern »Von der Neuschöpfung des Menschen« die Rede sein muss, gibt bereits einen wichtigen zu entfaltenden Grundgedanken dieses Artikels wieder. Ein Unterschied zum ersten und zweiten Credoartikel besteht darin, dass die erste Bekenntniszeile über den »Glauben an den Heiligen Geist« nicht ohne Weiteres durch die anderen Aussagen des Artikels entfaltet wird. Diese stehen zunächst syntaktisch in einem offeneren, komplementären Verhältnis zur Aussage über den Glauben an den Geist. Gleichzeitig sind natürlich Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben konkreter Ausdruck des schöpferischen Wirkens des Geistes Gottes.
In einem ersten Diskursgang erörtert mein eigener Beitrag zunächst das Verhältnis von Glauben und Geist, und zwar unter der Maßgabe, dass die Rede vom Heiligen Geist stets unter den Bedingungen menschlicher Existenz und menschlicher Erfahrung geschieht und daher die anthropologische Frage nach dem Selbst und dem Bewusstsein des Menschen zentral ist. Die neutestamentliche Überlieferung wird auf diese Aspekte hin vorgestellt und interpretiert und ein personhaftes Verständnis des Geistes im Sinne der klassischen Trinitätslehre kritisch hinterfragt. Das Ziel ist eine Antwort auf die Frage, was konkret vom neutestamentlichen Befund her mit dem »Glauben an den Heiligen Geist« bekannt wird. In systematisch-theologischer Hinsicht stellt Martin Laube sehr grundsätzliche Überlegungen zur Pneumatologie zur Diskussion. Er geht dabei von der Feststellung aus, dass die Lehre vom Heiligen Geist ein »ungelöstes Dauerproblem der Dogmatik« darstelle (322). Eine forschungsgeschichtliche Orientierung erhellt diese Problematik und mündet in bemerkenswerte Anregungen unter den Aspekten der Sozialität, der Medialität und der Kreativität des Geistes. Gerade im Blick auf seine Wirkungen im religiösen Kommunikations- und Sinnbildungsprozess des Glaubens erweise sich der Geist als »das geschichtliche Traditionsprinzip des Christentums« (344).
Für die ekklesiologische Aussage des dritten Artikels erläutert Markus Öhler facettenreich die neutestamentlichen Zeugnisse für das Verständnis der Gemeinde als ecclesia und zugleich als »Gemeinschaft der Heiligen«. Dies geschieht unter der Maßgabe, dass der Geist das bestimmende Moment des dritten Artikels sei. Der Fokus liegt auf der paulinischen Ekklesiologie, wobei dem Epheserbrief in mancher |9|Hinsicht eine Sonderstellung zukommt. Doch auch die Linien anderer Traditionsbereiche des Neuen Testaments werden anschaulich ausgezogen. Hans-Peter Großhans fragt – von reformatorischer Ekklesiologie speziell lutherischer Prägung ausgehend – sehr grundsätzlich, was die Kirche sei. Wichtig ist ihm dabei vor allem die Frage nach der Katholizität und Heiligkeit der Kirche als Leib Christi, die er »im Geheimnis Jesu Christi, in Jesus Christus als dem Sakrament« begründet sieht (392). Besonders interessant erscheint die These, dass die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen »ihre Heiligkeit in einem dreifachen Diakonat« unter den Aspekten der Wahrheit, der Liebe und der Hoffnung realisiere (393). Freiheit sei die besondere Ambition und Herausforderung der sich evangelisch nennenden Kirche, die der Wahrheit des Evangeliums verpflichtet sei.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.