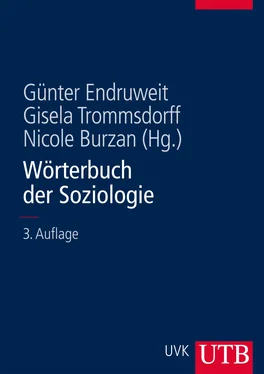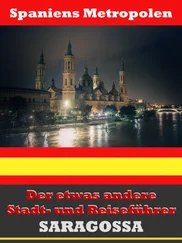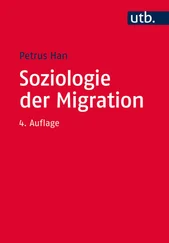Angesichts der Unausweichlichkeit von Ethnozentrismus beim erstmaligen Wahrnehmen und[109] Überdenken von sozialen Phänomenen sind sowohl Alltags- als auch wissenschaftliche Theorie n in ihrem Anfangsstadium häufig ethnozentrisch. Werden sie ohne Überprüfung auf ihre Richtigkeit auch in einer anderen Kultur dort zur Grundlage von praktischen Maßnahmen gemacht, können sie zu schwersten Schäden führen. »Die meisten Studien aus der ›Comparative Management‹ Schule sind amerikanisch-ethnozentrisch. Um den Ethnozentrismus zu beschränken, ist es unentbehrlich, dass Kulturforscher Toleranz für abweichende Werthaltungssysteme entwickeln und dass sie versuchen, ihre eigenen Werthaltungen explizit zu machen. Es ist wünschenswert, dass die Forschungsgruppen Forscher verschiedener Kulturen umfassen und/oder zwei- oder mehrkulturelle Forscher, d. h. Personen, die in mehr als einer Umweltkultur erzogen sind, gelebt und/oder gearbeitet haben« (Hofstede, Sp. 1176).
Gesellschafts- oder Kulturvergleich sind unabdingbarer Bestandteil der Theorieprüfung , wenn die Theorie nicht nur für eine einzige Gesellschaft gelten soll. Dabei sind Idealtypen ein Instrument zur Vermeidung von Ethnozentrismus, ebenso die automatische Suche nach funktionalen Äquivalenten oder überhaupt funktionale Analysen, möglichst noch in mathematischer Formulierung. Die kleine Schwester des Ethnozentrismus ist die persönliche Voreingenommenheit (engl. bias ). Ansätze zur Vermeidung des intrasozietären Ethnozentrismus bieten etwa die Verstehende Soziologie (vgl. Max Webers Begriff des Handelns ) und die Ethnomethodologie . Das Gegenteil von Ethnozentrismus und für die Validität der Ergebnisse genauso schädliche Abweichen von der wissenschaftlichen Objektivität ist das »going native« (Lamnek, Bd. 1, 49, 235; Bd. 2, 259).
Literatur
Forbes, Hugh Donald, 1985: Nationalism, Ethnocentrism, and Personality, Chicago/London. – Hofstede, Geert, 1980: Kultur und Organisation; in: Grochla, Erwin (Hg.): Handwörterbuch der Organisation, 2. Aufl., Stuttgart, Sp. 1168–1182. – Lamnek, Siegfried, 1993 bzw. 1989: Qualitative Sozialforschung, Bd. 1, 2. Aufl., Bd. 2, 1. Aufl., München.
Günter Endruweit
Evaluation
Evaluation (engl. evaluation) steht nicht nur für spezifisches Handeln, das die Bewertung von empirisch gewonnenen Informationen zum Ziel hat, auf deren Basis rationale Entscheidungen getroffen werden können, sondern auch für das Ergebnis dieses Prozesses. Wissenschaftlich durchgeführte Evaluationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie (a) auf einen klar definierten Gegenstand bezogen sind; (b) dass für die Informationsgewinnung objektivierende empirische Datenerhebung smethoden eingesetzt werden und dass (c) die Bewertung anhand präzise festgelegter und offengelegter Kriterien, (d) mit Hilfe systematisch vergleichender Verfahren vorgenommen wird. Die Evaluation wird (e) in der Regel von dafür besonders befähigten Personen (Evaluatoren) durchgeführt, um (f) auf den Evaluationsgegenstand bezogene Entscheidungen zu treffen.
Damit das Nutzungspotenzial von Evaluationen möglichst optimal ausgeschöpft wird, hat sich jede professionell durchgeführte Evaluation mit folgenden fünf Fragen auseinanderzusetzen: 1) Was (welcher Gegenstand), wird 2) wozu (zu welchem Zweck), 3) anhand welcher Kriterien, 4) von wem, 5) wie (mit welchen Methoden) evaluiert?
1) Gegenstand: Im Prinzip gibt es bei der Wahl des Evaluationsgegenstands kaum Einschränkungen. Objekte der Bewertung können Gesetze, Produkte, Dienstleistungen, Organisationen, Personen, Prozesse sowie soziale Tatbestände jedweder Art oder gar Evaluationen selbst sein. Häufige Evaluationsgegenstände sind allerdings Reformmaßnahmen, Projekte, Programme oder Policies.
2) Funktionen: Evaluationen können folgenden vier unterschiedlichen, aber miteinander verknüpften Funktionen dienen: (a) Der Gewinnung von Erkenntnissen, um die Prozessabläufe oder die Wirkungszusammenhänge in einem Programm zu verstehen. (b) Um Kontrolle auszuüben, indem festgestellt wird, ob die in der Planung festgelegten Ziele erreicht wurden. (c) Um Lernpotenziale zu eröffnen, die für die Weiterentwicklung von Programmen genutzt werden sollen. (d) Um Programme zu legitimieren, indem öffentlich belegt wird, wie nützlich, wirksam oder nachhaltig sie waren.
Da Evaluationen mittlerweile als Ausdruck mo derner, »evidence based policy« gelten, werden[110] Evaluationen mitunter auch missbraucht, indem sie dazu verwendet werden, politisch bereits getroffene Entscheidungen nachträglich mit Hilfe von Evaluationsergebnissen zu legitimieren. Diese »taktische« Funktion von Evaluation lässt sich jedoch nicht mit ihrem eigentlichen Zweck begründen, sondern stellt eher ihre pathologische Seite dar.
Die Festlegung auf eine prioritäre Funktion steu ert die Herangehensweise und bestimmt das Design und die Durchführung von Evaluationen. Diese können nicht nur verschiedene Funktionen erfüllen, sondern im Rahmen der einzelnen Phasen der Programmentwicklung auch unterschiedliche Analyseperspektiven und Erkenntnisinteressen verfolgen. Evaluationen können dazu genutzt werden, (a) die Planung eines Programms oder einer Maßnahme zu verbessern ( ex-anteEvaluation), (b) die Durchführungsprozesse zu beobachten ( ongoingEvaluation) oder (c) die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Interventionen ex-post zu bestimmen ( ex-postEvaluation).
Evaluationen können demnach mehr formativ, d. h. aktiv-gestaltend, prozessorientiert, konstruktiv und kommunikationsfördernd angelegt sein, oder mehr summativ, d. h. zusammenfassend, bilanzierend und ergebnisorientiert.
Die Begleitforschung kann als eine besondere Form der Evaluation gelten, die sich ex-ante mit den Voraussetzungen bzw. der Planung oder (ongoing) mit der Implementation von Programmen beschäftigt. Anders als die meisten Evaluationen wird sie nicht nur punktuell, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Programmverlauf eingesetzt, sondern kontinuierlich – programmbegleitend. Dadurch können Längsschnittdaten gewonnen werden, die nicht nur kontinuierlich über Veränderungsprozesse informieren, sondern auch Ursache-Wirkungszuschreibungen erleichtern.
Eine besonders wichtige Form der Evaluation stellt die Wirkungsevaluationdar, die zum einen darauf abzielt, (idealerweise) möglichst alle beabsichtigten (intendierten) und nicht-intendierten Wirkungen zu erfassen und die zum anderen mit größtmöglicher Zuverlässigkeit feststellen soll, welche Ursachen (die Programminterventionen oder andere Faktoren) dafür verantwortlich sind. Diese Aufgabe stellt eine der größten Herausforderungen einer Evaluation dar. Dies liegt vor allem daran, dass die soziale Welt einen hohen Komplexitätsgrad aufweist, d. h. die meisten sozialen Phänomene auf vielen Ursachen basieren. Interventionen haben zudem in der Regel nur einen geringen Eingriffsspielraum und ein niedriges Veränderungspotenzial. Oft sind die Programm- oder Leistungswirkungen nur schwach ausgeprägt, und es besteht selbst bei professionellem Einsatz von Auswertungsverfahren die Gefahr, dass sie im allgemeinen ›Rauschen‹ gar nicht erkannt werden.
3) Kriterien: Im Unterschied zu Normenreihen (wie ISO, oder EFQM) kann Evaluation nicht auf einen fixierten Kanon von Bewertungskriterien zurückgreifen. Sehr häufig orientieren sich die Bewertungskriterien allerdings am Nutzen eines Gegenstands, Sachverhalts oder Entwicklungsprozesses für bestimmte Personen oder Gruppen. Die Festlegung der Kriterien kann durch den Auftraggeber (direktiv), durch den Evaluator (wissens-/erfahrungsbasiert) oder durch alle Stakeholder (partizipativ) erfolgen, um möglichst viele Perspektiven zu berücksichtigen.
Читать дальше