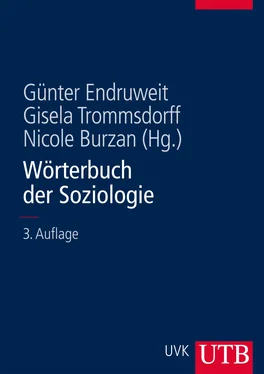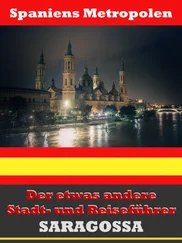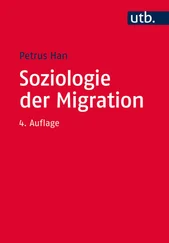Nationalcharakter
Netzwerk
Norm und Sanktion
Operationalisierung
Organisationssoziologie
Organismustheorie
Persönlichkeit(sentwicklung)
Phänomenologie
Politiksoziologie
Position
Positivismus
Praxis
Prestige
Pretest
Probleme, soziale
Professionalisierung
Prognose
Proletariat
Prozess, sozialer
Qualifikation
Rasse
Rational Choice Theorie / Theorie der rationalen Wahl
Rationalisierung
Rationalismus, Kritischer
Rationalität
Raum, sozialer
Raumforschung und Raumplanung
Rechtssoziologie
[7]Reduktionismus
Regressionsanalyse
Reiz
Religionssoziologie
Revolution
Risiko
Ritual
Rolle
Rückkopplung
Schicht, soziale
Segregation
Sekundäranalyse
Sexualität
Sippe
Skalierung
Sozialarbeit
Sozialdarwinismus
Sozialethik
Sozialgeographie
Sozialgeschichte
Sozialisation
Sozialkunde
Sozialökologie
Sozialpädagogik
Sozialphilosophie
Sozialpolitik
Sozialpsychologie
Sozialstruktur
Sozialwissenschaften
Soziologie
Soziologie, Allgemeine und Spezielle
Soziologie, marxistische
Soziologie, mathematische
Soziologie, strukturell-individualistische
Soziologie, verstehende
Soziologie, visuelle
Soziometrie
Soziotechnik
Sportsoziologie
Sprachsoziologie
Stadtsoziologie/Gemeindesoziologie
Stand
Ständegesellschaft
Statistik
Status
Struktur
Strukturalismus
Studie, komparative
Subjekt, soziales
Subkultur
Sukzession
Symbol
Symbolischer Interaktionismus
Systemtheorie
Tabellenanalyse
Tabu
Tausch
Taylorismus
Techniksoziologie
Thanatosoziologie
Theorie
Theorie des Handelns
Theorie des kommunikativen Handelns
Theorie, kritische
Theorie, strukturell-funktionale
Tradition
Umweltsoziologie
Ungleichheit, soziale
Utopie
Verband
Verfahren, multivariate
Verfahren, nichtreaktive
Vergleich, interkultureller, intersozietärer
Vergleich, sozialer
Verhalten, abweichendes
Verhalten, konformes
Verhalten, prosoziales
Verhaltensmuster
Verhaltenstheorie
Verstädterung
Vorurteile
Wahrnehmung, soziale
Wahrscheinlichkeit
Wandel, sozialer
Werbung
Wert/Wertewandel
Wertfreiheit/Werturteilsproblem
Wirtschaftssoziologie
Wissenschaft
Wissenschaftssoziologie
Wissenschaftstheorie
Wissenssoziologie
Zeit
Zensus
Zivilgesellschaft
Zivilisation
Zukunftsforschung
Register
Autorenverzeichnis
[8][9]Vorwort
Sozialer Wandel ist eines der großen Themen der Soziologie. Sozialen Wandel hat auch dieses Wörterbuch der Soziologie erlebt. Die erste Auflage erschien 1989 im Ferdinand-Enke-Verlag, der später die Veröffentlichung von Soziologie-Büchern einstellte (nicht etwa wegen dieses Wörterbuchs!). Deshalb kam die zweite Auflage 2002 im Verlag Lucius & Lucius heraus, dessen Verleger sein UTB-Programm 2010 aus Altersgründen der UVK Verlagsgesellschaft übertrug, die nun diese dritte Auflage betreut hat und zudem digitale Fassungen des Wörterbuchs plant. Wir danken hier insbesondere Sonja Rothländer für ihre wertvolle Unterstützung.
Wozu braucht man, ob in gedruckter oder digitaler Variante, im Zeitalter schneller Informationsbeschaffung im Internet noch ein Wörterbuch der Soziologie? Für die Herausgeber, für die Autorinnen und Autoren, für Soziologinnen und Soziologen liegt auf der Hand, dass die fachlich fundierte Einordnung des vielfältigen sozialen Wandels in gesicherter Weise von Expertinnen und Experten erfolgen sollte, die aktuell in den verschiedenen Themengebieten der Soziologie forschen, und dass dabei insbesondere der soziologische Blick auf Phänomene wie Emotionen, Markt oder Recht, die ja auch von anderen Disziplinen thematisiert werden, im Fokus der Aufmerksamkeit steht.
Sozialer Wandel zeigt sich entsprechend auch im Inhalt des Wörterbuchs. So wurden als neue Stichworte z. B. aufgenommen: Ehrenamt, Exklusion/Inklusion, Innovation, Interdisziplinarität, Kommunikationssoziologie, Körpersoziologie, Lebenslaufforschung, Risiko, Thanatosoziologie und Wissenschaftssoziologie. Im Übrigen wurde das frühere Konzept beibehalten. Neben der bewährten Mischung aus längeren und kürzeren Beiträgen ist unter anderem kennzeichnend, dass Sie als Leserinnen und Leser sowohl nach Stichworten suchen können, denen ein eigener Beitrag gewidmet ist, als auch nach Begriffen im Register, sodass Querbezüge leicht herzustellen und Sachverhalte ohne eigenen Beitrag gut auffindbar sind.
Außerdem ist eine Veränderung in der Herausgeberschaft eingetreten. Die ursprünglichen Herausgeber danken Nicole Burzan dafür, dass sie bereit war, sich der zeit- und nervenaufreibenden Arbeit zu unterziehen und zur Kontinuität bereit zu sein. Auch im Kreis der Autorinnen und Autoren ergaben sich aus unterschiedlichsten Gründen große Veränderungen. Wir danken allen, die zu dieser Auflage Beiträge geliefert haben, für ihre Mühe.
Wir hoffen, mit dieser neuen Auflage allen an der Soziologie Interessierten eine nützliche Hilfe leisten zu können.
Kiel/Konstanz/Dortmund, im Januar 2014
Günter Endruweit/Gisela Trommsdorff/
Nicole Burzan
[10][11]A
Abhängigkeit
Abhängigkeit (engl. dependence, dependency) bezeichnet einen für eine längere Zeit anhaltenden zwischenmenschlichen Zustand in Dyaden oder Gruppen als Ergebnis wiederholt abgelaufener Prozesse sozialer Bindung meist mit asymmetrischen und komplementären Tendenzen in Interaktion und Kommunikation : etwa als Gehorsam gegenüber Herrschaft oder Macht in hierarchisch gegliederten sozialen Gebilden (hierarchische Abhängigkeit) oder paradigmatisch im Rahmen der primären Sozialisation als überwiegend gefühlsmäßige Beziehung zwischen Kleinkind und Dauerpflegeperson (emotionale Abhängigkeit). Dabei sind generell und über die Bedingungen der Primärsozialisation hinaus Verhaltensdispositionen wie die Suche nach körperlicher Nähe, Fürsorge, Beachtung und Anerkennung oder die Angst vor Trennung, sozialer Isolation und Einsamkeit charakteristisch (Abhängigkeitsbedürfnis). Es können sich daraus wechselseitige Abhängigkeitsverhältnisse ergeben, die unter dem Aspekt abweichenden Verhaltens zu untersuchen sind, insofern sie nicht für eine Übergangsphase soziokulturell gebilligt werden (z. B. bei Liebespaaren) oder sich auf soziale Phänomene des Tausch es beziehen, die Gegenstand von kulturanthropologischen Tauschtheorien und verhaltenstheoretischen Austauschtheorien sind.
Daneben wird der Begriff Abhängigkeit verwendet, um eine Beziehung von Personen zu Sachen zu kennzeichnen: etwa in der Arbeitsorganisation, wo sich die Rolleninhaber einer Steuerung und Kontrolle durch technische und nicht-technische Technologien unterwerfen (funktionelle Abhängigkeit), oder im Bereich des nicht mehr kontrollierbaren, süchtigen Konsums von psychotropen Substanzen, z. B. Alkohol (Abhängigkeitssyndrom), der Gegenstand der Soziologie sozialer Probleme ist.
Siegfried Tasseit
Abhängigkeitstheorien
Die Abhängigkeitstheorien ( Dependenztheorien , engl. dependency theories) entstanden Ende der 1960er Jahre in Lateinamerika als Reaktion auf ausbleibende Entwicklungserfolge. Bei den Abhängigkeitstheorien handelt es sich nicht um ein geschlossenes Theoriegebäude, sondern um eine beträchtliche Zahl konkurrierender bzw. aufeinander aufbauender Ansätze (zusammenfassend Menzel 2010: 97–124, Boeckh 1982). Allen gemein ist, dass sie sich von den bis dahin in der Entwicklung stheorie dominierenden ökonomischen Aushandelstheorien und den sozialwissenschaftlichen Modernisierungstheorien absetzen und Entwicklungsprozesse im Rahmen internationaler ökonomischer und politischer Herrschaftsprozesse analysieren. Kurz gefasst sehen sie die fehlende Entwicklung der Dritten Welt als eine Folge der Entwicklung der Ersten Welt an.
Читать дальше