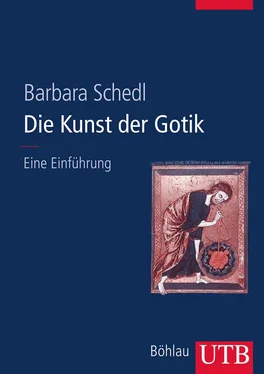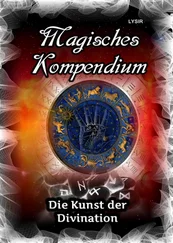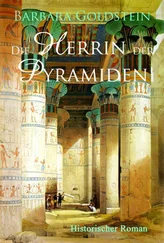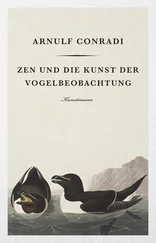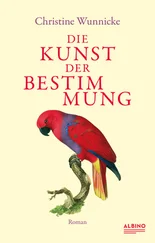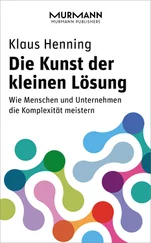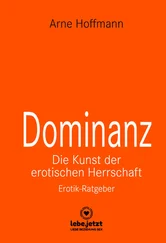In Bologna, Paris, Oxford, Cambridge usw. entstand dann um 1200 ein weiterer neuer Typ einer Bildungsinstitution – die Universität. Diese unterschied sich von den (herkömmlichen) Schulen durch die Qualität des Unterrichts, die universelle Geltung der verliehenen Grade und durch den Erwerb kaiserlicher (bzw. königlicher) und päpstlicher Privilegien.
Wohl waren die einzelnen Universitäten unterschiedlich strukturiert. Es lassen sich aber dennoch grundlegende Gemeinsamkeiten feststellen: Es gab vier Fakultäten: die sieben Artes liberales (sieben freie Künste) als Grundlagenstudium und dann Medizin, Recht und Theologie. Zu den septem artes liberales zählten Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Den Artes liberales standen die praktischen Künste, Artes mechanicae, also handwerkliche Fertigkeiten, gegenüber. Die einzelnen Disziplinen bildeten jeweils eine geschlossene Fakultät, an deren Spitze der Dekan stand. An Universitäten mit weitem Einzugsbereich, besonders in Bologna und Paris, waren die Studenten nach ihrer Herkunft in nationes zusammengeschlossen.
Das Universitätsstudium konnten im Prinzip Studenten jeder sozialen oder regionalen Herkunft aufnehmen; mehrheitlich waren es aber Angehörige oder Beauftragte der Oberschicht. Die Päpste, die Könige von Frankreich, England und Kastilien unterstützten die Institutionalisierung der Universitäten, um die Entwicklung von qualitätsvollen Studien und die Ausbildung von hochgebildeten Theologen und Juristen, aber auch Medizinern zu fördern – nicht zuletzt, um selbst von deren Wissen zu profitieren. Grundlage der Lehrinhalte waren zum einen die christliche Lehre, zum anderen antike Wissenschaftstraditionen (wie Donatus, Priscianus, Aristoteles, Galen und Avicenna, das Corpus iuris civilis und das Corpus iuris canonici), ergänzt durch die Schriften der Kirchenväter, arabischer Gelehrsamkeit und der Kommentatoren der frühen Scholastik.
[<<18]
2.4 Zusammenfassung: Neue Bild- und Raumformen
Die skizzierten umwelthistorischen, gesellschafts- und kirchenpolitischen Veränderungen hatten Auswirkungen auf Vorstellungen und Handlungsprozesse der damaligen Menschen, aber auch auf Herstellungspraxis der Gebäude, Kunstwerke und Gegenstände und führten zu neuen Bild- und Raumkonzepten. So benötigte man im Zuge der Entwicklung der städtischen Lebensräume neue Versammlungsorte für die Organisation des Gemeinschaftslebens. Es entstanden damit neue Bauaufgaben, wie die Errichtung von Rathäusern, Zunfthäusern oder Hospitälern. Großbaustellen in den Städten waren wichtige Wirtschaftsfaktoren. Die Bauhütte war der zentrale Ort, an dem sich die Handwerker (Baumeister, Steinmetz, Maler, Schmied, Maurer usw.) zusammenfanden, um an dem Bau und seiner Ausstattung zu arbeiten. Damit verlagerte sich die Kunstproduktion seit der Mitte des 13. Jahrhunderts von den Klöstern zu den (berufsmäßigen) Künstlern in die Stadt.
Auch die Buchproduktion fand nicht mehr in klösterlichen Skriptorien (Schreibstuben) statt, sondern verlagerte sich in die Städte, besonders in jene Zentren, in denen es auch Universitäten gab und wo ein wachsender Bedarf an juridischen, philosophisch-didaktischen sowie medizinischen Schriften gedeckt werden musste. Neben wissenschaftlichen Texten für den Lehrbetrieb und religiösen Büchern für die private Andacht (Psalter, Stundenbuch, Brevier) verbreiteten sich vermehrt auch illustrierte höfische bzw. allegorische Romane.
Es trat im Laufe des 14. Jahrhunderts eine immer größere Spezialisierung ein. Sowohl das Ansehen als auch die Arbeitsbedingungen der Künstler verbesserten sich. Der Künstler, sei es der Baumeister, Architekt oder der Maler, gewann an Prestige. Die Künstler wurden an die Höfe der Könige und Fürsten gerufen, sie fungierten als wichtige Berater und als Spezialisten und wurden großzügig entlohnt. Zugleich avancierten die in den Städten lebenden Bürger neben dem Landesfürsten, den Stadtherren und dem hohen Klerus zu wichtigen Auftraggebern von Kunstwerken. Das zeigt sich in der Finanzierung der Kirchenbauten (Kathedralen, Pfarrkirchen, Hospitäler, Rathäuser und Klosterbauten) und den Stiftungen von Bildwerken, aber auch in den durch Schriftquellen überlieferten Berufungskommissionen und Künstlerverträgen für auswärtige Künstler (Baumeister).
Mit dem Aufkommen der Bettelorden entwickelte sich ein neuer Typ von Klosterbauten, da diese aufgrund ihres Armutsideals auf Wirtschaftsgebäude verzichten konnten. Diese neuen städtischen Ordenshäuser – meist in den Erweiterungsgebieten an den Stadtmauern gelegen – wurden durch Schenkungen oder Spenden von der Bevölkerung für die Ordensbrüder und -schwestern errichtet. Ihre Kirchen waren im Gegensatz zu denen der alten Orden auf eine hohe Besucherfrequenz ausgelegt; dementsprechend orientierte sich ihr Baukonzept auf eine Zweiteilung des Kirchenraumes, um getrennte Bereiche für Laien und Mönche bzw. Nonnen zu schaffen.
Bautechnische Innovationen, neue Formen und Designs, wissenschaftliche Erkenntnisse sowie gesellschafts- und kirchenpolitische Ereignisse bzw. Konzepte verbreiteten sich nicht nur im Kernland der Gotik, in Frankreich, sondern über dessen Grenzen hinweg. Die Netzwerke funktionierten nicht nur über die herrschaftliche Ebene – die adelige und geistliche Elite (König, Bischof usw.) –, sondern auch über verschiedene andere soziale Gruppen (Kaufleute, Händler, Künstler, Gelehrte und Studenten) sowie über Klostergemeinschaften, wie etwa die Zisterzienser und Bettelorden (Dominikaner und Franziskaner, auch Minoriten genannt).
[<<19]
Seit dem 13. Jahrhundert entwickelte sich, wie erwähnt, auch ein berechenbarer Zeitbegriff, der sich in der präzisen und der breiten Bevölkerung zunehmend gegenwärtigen Zeitmessung durch die mechanischen Uhren widerspiegelte. Die deutliche Wahrnehmung der Begrenztheit des menschlichen Daseins, also der irdischen Zeit, förderte aber auch eine starke Betonung der nachirdischen Zeit. Die Beschäftigung mit der eigenen Zukunft bedeutete eine Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Tag des Jüngsten Gerichts. Der starke Jenseitsbezug der damaligen Gesellschaft drückt sich in der Praxis des Totengedächtnisses, in der Stiftungstätigkeit und der Schaffung von neuen Darstellungstypen (Weltgericht) sowie in Bau- und Ausstattungskonzepten (z.B. Memorialchor Elisabethkirche in Marburg, Andachtsbilder) aus. Die Pestpandemien, die sich im 14. Jahrhundert feststellen lassen, hatten nicht nur demografische, wirtschaftliche und kulturgeschichtliche (Judenverfolgung, Flagellanten- und Geißlerzüge) Auswirkungen; die Folgen waren wesentlich komplexer und führten zu einer veränderten Einstellung zum Tod, was sich ebenfalls in der Konstruktion von neuen Darstellungsformen in den Bildkünsten und Grabmonumenten widerspiegelt, wie in Darstellungen von halbverwesten Personen oder tanzenden Skeletten (z.B. am Grabmal des Kardinal de la Grange).
Die Vermittlung von Glaubensinhalten war ein zentrales Thema der Kirche und ganz besonders der Bettelorden. Im Laufe des 13. Jahrhunderts bekamen auch einfache Laien immer mehr Zugang zu religiösen Darstellungen und Erlebnissen. Es setzte eine zunehmende Begeisterung für Bilder ein, und es entstanden je nach Andachtszweck oder gesellschaftlicher Gruppe unterschiedliche Bildtypen. Ganz besonders die Franziskaner gebrauchten für ihre Predigtarbeit gerne Bilder und entwickelten auch neue visuelle Ausdrucksmittel. Franz von Assisi ließ z.B. zu Weihnachten 1223 in einem Wald bei Greccio eine Christuskrippe aufstellen, um den Menschen eine lebendige Darstellung von Christi Geburt vorzuführen. Die Wahrnehmung des Göttlichen wird den Menschen damit bildlich vor Augen geführt. Unsichtbares sollte begreiflich und fassbar gemacht werden.
Die bei der Messe zelebrierte Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi wurde im Vierten Laterankonzil 1215 kodifiziert. Dieses Dogma war von zentraler Bedeutung für die christlichen Gläubigen und wurde fortan in der Liturgie immer stärker theatralisch inszeniert sowie in zahlreichen Bilddarstellungen sichtbar gemacht. Die Messe gestaltete sich dank der Rituale, der aus kostbarem Material hergestellten Altargeräte und kirchlichen Gewänder, des Gesangs und Glockenschlages, der kostspieligen Lichtinszenierung durch Kerzen und Glasfenster, des Weihrauch- und Blumenduftes sowie durch Berühren und Verspeisen der Hostie zu einem außergewöhnlichen Ereignis, das alle menschlichen Sinne ansprechen sollte. Zu diesen sinnlichen Inszenierungen der Eucharistiefeier gehörten auch die bildreichen Portalprogramme an den Kathedralen, das Zurschaustellen der Reliquien in kostbaren Behältnissen auf Altären und Bühnen und das Zeigen und Verbergen der großen Bildtafeln gotischer Flügelaltäre.
Читать дальше