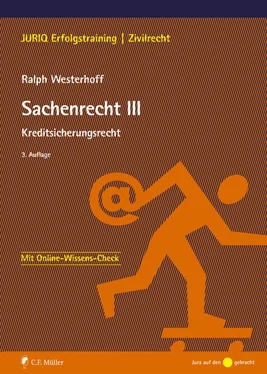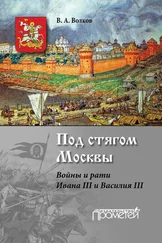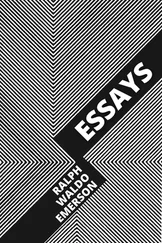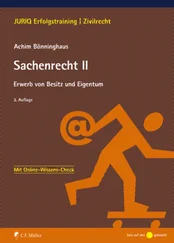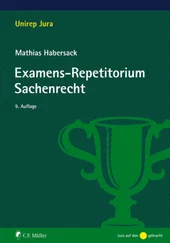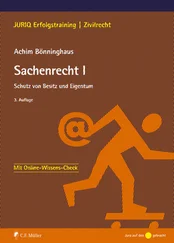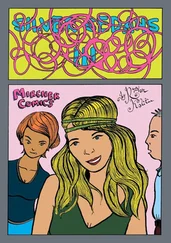Außerdem kann man die Grundschuld (und die mit ihr verbundenen Probleme im Rahmen der Kreditsicherung) nur begreifen, wenn man zuvor die Hypothek verstanden hat. Dies wiederum setzt voraus, dass Ihnen der Begriff der Akzessorietät geläufig ist.[13] Im Überblick:
28
Sehen Sie sich hierzu die §§ 401, 1113, 1153, 1163 an.
Eine Hypothekist eine akzessorische Realsicherheit. Das klingt kompliziert, ist aber durch den Vergleich mit der Bürgschaft leicht zu verstehen: Auch der Bürge haftet nur soweit, wie die Forderung besteht. Geht sie unter oder ist sie erst gar nicht entstanden, gibt es auch keine Rechte aus der Bürgschaft. Ähnliches gilt für die Hypothek: Sie steht dem Gläubiger nicht zu, wenn die gesicherte Forderung nicht entsteht bzw. wieder erloschen ist, § 1163.
Auch bei der Übertragung der Forderung wandert die Hypothek genauso mit wie die Bürgschaft. Eine isolierte Übertragung der Forderung ist also konstruktiv ausgeschlossen, § 1153. Oder, um es exakt zu formulieren: Eine Hypothek kann gar nicht abgetreten werden. Abgetreten wird immer nur die Forderung, an der die Hypothek „klebt“.
29
Im Unterschied zur Bürgschaft kann man den Sicherungsgeber einer Hypothek (= Eigentümer des belasteten Grundstücks) aber nicht auf Zahlung verklagen, sondern „nur“ auf Duldung der Zwangsvollstreckung, § 1147. Natürlich kann der Eigentümer zahlen, um das zu vermeiden (§ 1142). Dadurch erwirbt er die Forderung, wie sich aus § 1143 ergibt. Der Sicherungsgeber (= Eigentümer des Grundstücks) bezahlt also nicht etwa die Verbindlichkeit des Schuldners. Diese bleibt vielmehr bestehen und steht dem Eigentümer als Möglichkeit des Regresses zu (siehe gleich Rn. 32 f.).
Sie sehen also, dass die Hypothek nur ein „Anhängsel“ der gesicherten Forderung ist. Sie ist eben akzessorisch.
30
Obwohl die in den §§ 1191 ff. geregelte Grundschuldganz ähnlichen Zwecken dienen kann, wie die eben skizzierte Hypothek, ist sie doch völlig anders konstruiert. Im Unterschied zur Hypothek ist die Grundschuld nicht mit der gesicherten Forderung „verkoppelt“. Sie ist eben nicht akzessorisch. Das sagt § 1192 ausdrücklich. Die Grundschuld ist mit der besicherten Forderung nur schuldrechtlich, sozusagen „locker“ mit der besicherten Forderung durch den sogenannten Sicherungsvertrag verbunden. Sollte im Sicherungsvertrag als Zweck der Grundschuld die Absicherung einer Forderung vereinbart worden sein, spricht man von einer Sicherungsgrundschuld (siehe auch Wortlaut des § 1192 Abs. 1a)
31
Das hat weitreichende Konsequenzen. Kurz gesagt werden wir uns mit folgenden Problemen zu beschäftigen haben: Wie erhält der Sicherungsgeber „seine“ Grundschuld zurück, wenn der besicherte Kredit (ob durch ihn oder den Schuldner) bezahlt wurde? Wie kann der Sicherungsgeber geschützt werden, wenn der Gläubiger (vertragswidrig) Forderung und Grundschuld trennt?
[1]
Bülow Kreditsicherheit Rn. 1.
[2]
In diesem Skript werden die sehr speziellen Fragen der Schiffs- und Luftfahrzeugregister nicht erörtert.
[3]
Palandt- Sprau vor § 765 Rn. 2.
[4]
Siehe hierzu detailliert unter Rn. 150.
[5]
Zur Abgrenzung zur weichen Patronatserklärung siehe unten Rn. 121.
[6]
So für alle: Bülow Kreditsicherung ab Rn. 1543.
[7]
Palandt- Ellenberger vor § 104 Rn. 16.
[8]
Vgl. §§ 1205, 1206.
[9]
Palandt- Bassenge vor § 1204 Rn. 1; auf das Lombardgeschäft werden wir nicht weiter eingehen.
[10]
Weitere Beispiele für das gesetzliche Pfandrecht siehe: Palandt- Bassenge § 1257 Rn. 1 sowie umfassend: Schwerdtner JURA 1988, S. 251 ff.
[11]
Zu diesem Begriff siehe Medicus/Petersen Bürgerliches Recht Rn. 126 sowie Rn. 488 ff.
[12]
Das durchschnittliche Zahlungsziel in Deutschland beträgt derzeit rund 30 Tage!
[13]
So auch eindringlich Westermann Sachenrecht Rn. 544.
1. Teil Überblick› B. Der Regress
1. Teil Überblick› B. Der Regress› I. Die konstruktiven Möglichkeiten des Regresses
I. Die konstruktiven Möglichkeiten des Regresses
32
Der Regress, auch Rückgriff genannt, ist ein Spezialfall des Aufwendungsersatzes. Beim Aufwendungsersatz gibt es aber nur zwei Personen: Denjenigen, der Aufwendungen gemacht hat, und den, der daraus einen Vorteil zieht und deshalb die Aufwendungen zu erstatten hat.[1] Beim Spezialfall des Regresses sind aber zwingend drei Personenbeteiligt.[2]
33
Sie erinnern sich: Alle Kreditsicherungen haben die gleiche Struktur (s. Rn. 2 ff.). In jedemSachverhalt aus dem Bereich des Kreditsicherungsrechts gibt es (gedanklich) drei beteiligte Personen:
| 1. |
Der Gläubiger, also derjenige, der den Kredit zur Verfügung stellt. |
| 2. |
Der Schuldner, also derjenige, der den Kredit erhält und |
| 3. |
der Sicherungsgeber, also der, der mit einem Instrument des Kreditsicherungsrechts die Forderung absichert. |
Dass in vielen Fällen Schuldner und Sicherungsgeber identisch sind, ändert nichts daran, dass ihre Rolle (und damit die Anspruchsgrundlagen) andere sind, je nachdem, ob der Gläubiger aus der Forderung oder aus der Sicherheit vorgeht.
34
Regressfragen stellen sich also nur dann, wenn Schuldner und Sicherungsgeber verschiedene Personen sind.
Beispiel
Wenn der Studienrat O aus unserem Beispiel Rn. 3die Raten für den Kredit für sein Grundstück nicht mehr bezahlt, kann die Bank entweder ihn auf Zahlung aus dem Kreditvertrag verklagen oder (was sie meistens tut) aus der dinglichen Sicherheit vorgehen. Wie das genau geht, erarbeiten wir weiter unten ab Rn. 371.
Es macht in diesem Beispiel keinen Sinn über einen Regress nachzudenken. Denn wenn O sein Grundstück im Wege der Zwangsversteigerung verliert, dann doch deswegen, weil er die Raten nicht mehr bezahlt hat. Auf wen sollte er also im Sinne der folgenden Definition das Opfer, das er erbracht hat, abwälzen?
35
Nach allem können wir den Begriff Regress wie folgt definieren:

Der Regressist ein Aufwendungsersatzanspruch gegen eine Person, die durch die Leistung des Anspruchstellers an einen Dritten begünstigt ist, damit das in der Leistung liegende Opfer von dem Leistenden auf den Begünstigten abgewälzt werden kann.[3]
36
Grundsätzlich gibt es drei Wege, wie der Sicherungsgeber sich beim Schuldner schadlos halten kann:
37
Als erste (und leicht übersehene) Anspruchsgrundlage kommt natürlich eine Vereinbarung zwischen Schuldner und Sicherungsgeberin Betracht. Niemand kommt schließlich „einfach so“ auf den Gedanken, sich für die Schuld eines anderen z.B. zu verbürgen.
In aller Regel dürfte ein Auftrag oder auftragsähnliches Vertragsverhältnisvorliegen. Die entsprechende Anspruchsgrundlage für den Aufwendungsersatz ist dann § 670.
38
Bei allen akzessorischen Sicherungsmittelngewährt der Gesetzgeber dem leistenden Sicherungsgeber einen besonderen Anspruch. Da der Sicherungsgeber nicht eine fremde Schuld tilgen wollte, sondern vielmehr aufgrund seiner Haftung zahlt, geht die Forderung im Verhältnis zum Schuldner nicht unter. Der leistende Sicherungsgeber erwirbt diese kraft gesetzlicher Abtretung(cessio legis).[4] Der Sicherungsgeber erhält also die Forderung des Gläubigers und kann aus dieser gegen den Schuldner vorgehen.
Читать дальше