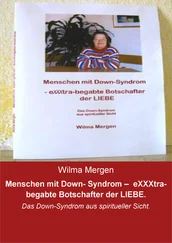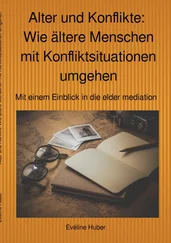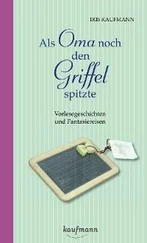Schwankungen in den Emotionen gehören zur Demenz.
Schwankungen in den Emotionen gehören zur Demenz. 
Mit der personenzentrierten Grundhaltung, die davon ausgeht, dass das Verhalten für die Personen in der jeweiligen Situation sinnvoll ist (Validierung), auch wenn es von außen betrachtet un-sinnig erscheint, können die dementiellen Symptome besser verstanden und akzeptiert werden.
Interindividuelle Variabilität
 Stereotype Zuschreibungen von Musikpräferenzen sind nicht sinnvoll.
Stereotype Zuschreibungen von Musikpräferenzen sind nicht sinnvoll. 
Gerade im Alter sind Präferenzen sehr unterschiedlich, daher sind »Pauschalangebote« für Menschen mit Demenz kritisch zu hinterfragen. Mit »An der schönen blauen Donau« wird ein Mensch der keinen Zugang zur klassischen Musik gefunden hat, kaum etwas anfangen können und vielleicht auch Weglauftendenzen zeigen. Es ist daher ratsam auch bei der Etablierung von musikalischen Angeboten dem differentiellen Altern gerecht zu werden und nach Passungen zwischen Angeboten und Musikpräferenzen zu suchen. Es ist wenig professionell, wenn bestimmten Altersgruppen bestimmte Musikgeschmäcker zugeschrieben werden. Als Negativbeispiel erinnere ich mich an eine Tätigkeit als Auszubildender auf einer gerontopsychiatrischen Station. Dort lief täglich acht Stunden lang Volksmusik, das Repertoire war mit acht CDs sehr eingeschränkt. Es ist zu vermuten, dass dies nicht von allen gewollt war und möglicherweise auch einen Teil der Symptome verursacht hat. Besonders dann, wenn Musik unreflektiert zur Milieugestaltung genutzt wird, und dauerhaft im Hintergrund zu anderen Aktivitäten erfolgt, kann dies auch schaden (vgl. Kersten 2019). Je kleiner der Kreis der Zuhörenden, umso eher ist es möglich, den individuellen Geschmack zu treffen. Dies ist bei der inhaltlichen Planung und der Organisation von musikalischen Angeboten zu beachten.
Musik hören und Musik gestalten
 Aktive Musikgestaltung fördert Kognition, Antrieb und verbessert die Stimmung.
Aktive Musikgestaltung fördert Kognition, Antrieb und verbessert die Stimmung. 
Neben der rezeptiven Begegnung mit Musik, sei es durch die gezielte Auswahl von Musikstücken oder im Sinne einer musikalischen Milieugestaltung, ist auch das aktive Gestalten von Musik, z. B. durch Singen oder Trommeln eine Möglichkeit, Menschen mit Demenz zu erreichen. Hier geht es um mehr als um das Erzeugen von positiven Emotionen, sondern auch um kognitive Förderung und die Reduktion von agitiertem Verhalten. Aktives Musizieren kann, jedenfalls in frühen und mittleren Phasen der Demenz auch die Teilnahme an sozialen Aktivitäten stärken. »Wie ein einmal angeworfener Dynamo kann Musik als Antriebselement betrachtet werden« (Kemser 2015, S. 122). Selbst das professionell unterstütze Schreiben von Musikstücken kann bei leichten Demenzformen möglich sein und positive Effekte entfalten (vgl. Ahessy 2017).
Es war ein Ansinnen dieses Kapitels, nicht nur einen Einblick in die Erlebniswelt der Menschen mit Demenz zu geben, sondern auch zu verdeutlichen, welche Potentiale Musik für Menschen mit Demenz entfalten kann. In vielfältigen Anekdoten, die auch in den nachfolgenden Kapiteln zu finden sind, wird die positive Wirkung beschrieben. In über 1.000 Studien wurden die Wirkung und Wirksamkeit der Musik bei Menschen mit Demenz untersucht. Es kann als belegt gelten, dass Musik und professionelle musiktherapeutische Ansätze das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität positiv beeinflussen. Während nur geringe Effekt auf die Agitation nachgewiesen worden sind, werden positive Effekte im Hinblick auf die Reduktion von Ängstlichkeit und depressiven Symptomen beschrieben (van der Steen et al. 2018). Die Auswahl geeigneter Angebote muss die Art der Demenz berücksichtigen (Baird & Samson 2015) und personenzentriert (»individualized music regimens«; Leggieri et al. 2019) gestaltet sein. Mit der Musiktherapie ist seit den 1970er Jahren eine eigene Praxiswissenschaft entstanden, die mit hohem Fachwissen Methoden entwickelt hat, wie Menschen mit Demenz an die Musik herangeführt werden können und positive Effekte erzielt werden können. Auch dort wird ein Ansatz favorisiert, der sich verständnisvoll für das Erleben in »Anderland« zeigt.
1.2 Versorgungssysteme für Menschen mit Demenz
Bernd Reuschenbach
Wer Musikangebote für Menschen mit Demenz entwickeln und anbieten möchte, der sollte folgende Fragen klären:
• Wo leben Menschen mit Demenz und deren Angehörige? Über welche Wege können diese erreicht werden?
• Welche finanziellen, räumlichen und personellen Ressourcen können für musikalische Angebote genutzt werden?
Dieses Kapitel beschreibt daher Orte und Institutionen in denen Menschen mit Demenz leben, gepflegt und betreut werden. Eine Fachdisziplin, die sich mit vorgenannten Fragen und deren rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigt, ist die Versorgungforschung. Der Begriff »Versorgung« ist nicht unumstritten, denn er impliziert, dass hier Menschen ausschließlich als Empfängerinnen bzw. Empfänger von Dienstleistungen gesehen werden, passiv durch das System geschleust werden und dabei nicht immer die tatsächliche »Sorge« um die Betroffenen im Mittelpunkt steht. Der Begriff Versorgung wird dennoch genutzt, denn er vereint alle Angebote für die Pflege, Betreuung, Teilhabe und das Wohnen von Menschen mit Demenz. In der Sozialgesetzgebung werden diese Versorgungsaspekte streng getrennt, was es für Betroffene und Angehörige nicht leicht macht. Es sollen hier Strukturen, Organisationen und Finanzierungsmöglichkeiten der Versorgung deutlich gemacht werden, denn diese stehen auch mit den musikalischen Angeboten in Verbindung.
1.2.1 Haus, Heim und noch viel mehr
Von den im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) knapp 4,1 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland leben gegenwärtig 20 % in stationären Pflegeeinrichtungen, 56 % werden zuhause überwiegend durch Angehörige versorgt und 24 % durch ambulante Pflegedienste (Statistisches Bundesamt 2020). Die Demenz verursacht in etwa der Hälfte aller Fälle die Pflegebedürftigkeit und ist in ca. 60 % der Fälle für Übergänge in Einrichtungen der Altenhilfe verantwortlich (Weyerer & Bickel 2007).
 je nach Versorgungsort unterschiedliche Ansprechwege
je nach Versorgungsort unterschiedliche Ansprechwege 
Die Möglichkeiten der Versorgung im eignen Zuhause (Haus) und der Versorgung in Einrichtungen der stationären Altenpflege (Heim) sind im Allgemeinen bekannt. Auf dem Kontinuum Haus vs. Heim sind in den vergangenen Jahren aber eine Vielzahl weiterer innovativer Versorgungsformen entstanden. Seit Einführung der Pflegeversicherung im Jahre 1995 wurden durch viele gesetzliche Anpassungen die Grundlagen dafür geschaffen, dass Menschen trotz schwerer Pflegebedürftigkeit dort leben können, wo sie es wollen, im eigenen Zuhause. Beispielsweise entstanden in den vergangenen Jahren Demenz-Wohngemeinschaften, Hausgemeinschaftsmodelle oder Quartierskonzepte (  Tab. 1.1) bei denen ein Mix aus Wohnen, Pflege und Betreuung realisiert wird. Für die jeweiligen Versorgungsformen sind unterschiedliche Ansprechwege zu wählen, um ein Musikangebot zu bewerben. 2
Tab. 1.1) bei denen ein Mix aus Wohnen, Pflege und Betreuung realisiert wird. Für die jeweiligen Versorgungsformen sind unterschiedliche Ansprechwege zu wählen, um ein Musikangebot zu bewerben. 2
Читать дальше
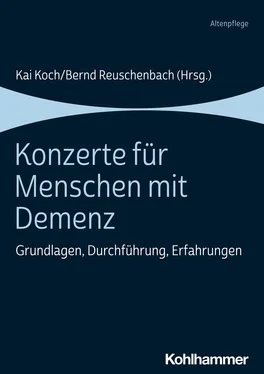
 Schwankungen in den Emotionen gehören zur Demenz.
Schwankungen in den Emotionen gehören zur Demenz.