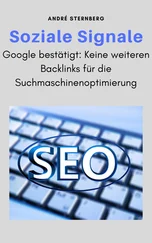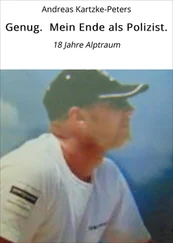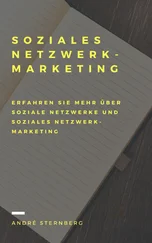5.2.1 Risikoidentifikation
5.2.2 Risikoanalyse
5.2.3 Risikobewertung
5.2.4 Risikosteuerung
5.2.5 Risikoüberwachung
6 Finanzierung
6.1 Klassische Finanzierung
6.2 Ergänzende Finanzierungsformen
6.2.1 Stiftungen
6.2.2 Investor-Betreiber-Modell
6.2.3 Public Social Private Partnership
6.2.4 Immobilienfonds
6.2.5 Mezzanine-Kapital
7 Personalmanagement
7.1 Personalplanung
7.2 Personalbeschaffung und Personalmarketing
7.3 Personalauswahl
7.4 Personalfreisetzung
7.5 Personalentwicklung
8 Qualitätsmanagement
8.1 Ziele und Elemente des Qualitätsmanagements
8.2 Bausteine zur Einführung von Qualitätsmanagement
8.2.1 Systematik
8.2.2 Das Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9000 ff.
EFQM-Modell
8.3 Aufbau des Qualitätsmanagementsystems
9 Marketing
9.1 Definition Marketing
9.2 Die vier Ps des klassischen Marketings
9.3 Leistungspolitik (Product)
9.3.1 Leistungs- bzw. Produktarten
9.3.2 Integration des externen Faktors
9.4 Preispolitik (Price)
9.4.1 Preisdifferenzierungen
9.4.2 Preisbündelung
9.5 Vertriebspolitik (Place)
9.6 Kommunikationspolitik (Promotion)
9.6.1 Strategien der Kommunikationspolitik
9.6.2 Kommunikationsinstrumente
9.7 Erweiterung auf sieben Ps
9.7.1 Personalpolitik (Personnel)
9.7.2 Prozesspolitik (Process)
9.7.3 Ausstattungspolitik (Physical Facilities)
Literatur
Sachregister
Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuches
Zur schnelleren Orientierung wurden Piktogramme benutzt, die folgende Bedeutung haben:

Literaturempfehlungen

Merksätze
Abkürzungsverzeichnis
AfA Absetzung vor Abnutzung
AO Abgabenordnung
AR Aufsichtsrat
BAB Betriebsabrechnungsbogen
Basel III Gesamtheit der Eigenkapitalvorschriften
BAT Bundesangestelltentarifvertrag
BH Behindertenhilfe
DIN Deutsche Industrienorm
DV-System Datenverarbeitungssystem
EDV Elektronische Datenverarbeitung
EE Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
EFQM European Foundation for Quality Management
EN Europa-Norm
FIBU Finanzbuchhaltung
FM-Daten Facility Management-Daten
GB Geistige Behinderung
GuV Gewinn- und Verlustrechnung
H 1 Haus 1
HGB Handelsgesetzbuch
ISO International Organization for Standardization
K 1 Klinik 1
Korresp. Korrespondenz
Kto. Konto
KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
L + G Lohn und Gehalt
MA Mitarbeiter
NPO Non-Profit-Organisation
PB Psychische Behinderung
PE Personalentwicklung
PDCA-Zirkel Plan Do Check Act-Zirkel
PK Personalkosten
PR Public Relations
QM Qualitätsmanagement
QM-Modell Qualitätsmanagement-Modell
QM-System Qualitätsmanagement-System
SGF Strategisches Geschäftsfeld
SK Sachkosten
Soz. Abg. Sozialabgaben
TN Teilnehmer
TQM-Modell Total Quality Management-Modell
TVÖD Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
W 1 Wohnbereich 1
WfbM Werkstatt für behinderte Menschen
Vorwort zur 3. Auflage
Das Thema „Betriebswirtschaftslehre“ spielt in allen sozialen Organisationen eine immer wichtigere Rolle. Auch nicht gewinnorientierte soziale Unternehmen (NPOs) müssen nachhaltig schwarze Zahlen schreiben, damit Neuinvestitionen finanziert werden können.
Viele Berufsgruppen, die in sozialen Einrichtungen Verantwortung tragen, stehen oft unvorbereitet vor Unternehmensentscheidungen. Häufig fehlt der Blick für betriebswirtschaftliche Rechenwerke und Zusammenhänge. Zumindest Grundlagenwissen in Betriebswirtschaftslehre gehört seit den frühen 1990er Jahren sicherlich zu einer modern und professionell ausgeübten Leitungstätigkeit in einem sozialen Unternehmen. In vielen sozialen Unternehmen ist das Thema „Betriebswirtschaftslehre“ allerdings viele Jahre sträflich vernachlässigt worden. Lange Zeit haben sich die Wissensgebiete des Sozialwesens und der Betriebswirtschaftslehre gemieden. Nicht das Trennende weiterhin zu betonen, sondern die gemeinsamen Fragestellungen zu erkennen und wahrzunehmen, ist Zielsetzung dieses Buches.
Natürlich stellt sich bei jedem einführenden Lehrbuch das ewige Dilemma zwischen allgemeinen Darlegungen und speziellen Anwendungsfragen, die, in Abhängigkeit von der jeweiligen Einrichtung, sehr unterschiedlich sein können.
Im Sinne einer Einführung wird im vorliegenden Band Grundlagenwissen in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Strategisches Management, Risikomanagement, Finanzierung, Personalmanagement, Qualitätsmanagement und Marketing vermittelt. Spezielle Anwendungsfragen für einzelne Tätigkeitsfelder (z. B. Controlling in Kindertageseinrichtungen) werden nur am Rande betrachtet, da diese den Rahmen des Buches gesprengt hätten. Angesichts der Komplexität und Breite des Themas können auch nicht alle Teilgebiete der Betriebswirtschaftslehre betrachtet werden.
Dieses Buch ist in erster Linie für Studierende gedacht. Es dürfte auch für Personen mit Führungsaufgaben in sozialwirtschaftlichen Unternehmen nützlich sein.
Remagen und Karlsruhe, im April 2020
Prof. Dr. G. Moos und A. Peters
1 Das Wirtschaften von sozialen Organisationen
1.1 Knappheit der Mittel
Die Knappheit der Mittel ist das Schicksal der Menschen. Nur in der Traumwelt des Schlaraffenlandes können sie diesem Los entkommen. Knappheit liegt dann vor, wenn die menschlichen Bedürfnisse bzw. Wünsche größer sind als die verfügbaren Mittel bzw. Ressourcen. Die Mehrzahl der Güter ist jedoch knapp im Verhältnis zu den menschlichen Bedürfnissen. Will der Mensch einen höheren Grad an Bedürfnisbefriedigung erreichen, muss er diese Güter gezielt vermehren, er muss wirtschaften.
Rationalprinzip
Wirtschaften ist der Inbegriff aller planvollen menschlichen Tätigkeiten, die unter Beachtung des ökonomischen Prinzips (Rationalprinzip) mit dem Zweck erfolgen, die – an den Bedürfnissen der Menschen gemessene – bestehende Knappheit an Gütern zu verringern.
knappe Güter
Die gezielte Vermehrung von knappen Gütern geschieht immer unter dem Einsatz von in einem Produktionsprozess miteinander kombinierten Produktionsfaktoren. Diese werden in der volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise in drei Kategorien eingeteilt:
 die natürlichen Ressourcen, oft verkürzt als Boden bezeichnet
die natürlichen Ressourcen, oft verkürzt als Boden bezeichnet
 die menschliche Arbeitskraft
die menschliche Arbeitskraft
 die Produktionsmittel
die Produktionsmittel
Die natürlichen Ressourcen sind grundsätzlich nicht vermehrbar. Die Natur bzw. der Boden wird daher als originärer Produktionsfaktor verstanden. Der Faktor „menschliche Arbeit“ wird durch die Zahl und Qualität der eingesetzten Arbeitseinheiten gemessen. Menschliche Arbeitskraft ist vermehrbar und in der Qualität durch Bildung und Ausbildung veränderbar. Die Produktionsmittel als dritter Produktionsfaktor werden hinsichtlich ihres Gesamtwertes häufig als Kapital bezeichnet. Der Produktionsfaktor Kapital besteht also aus produzierten Gütern, die ihrerseits wiederum zur Produktion von weiteren Gütern eingesetzt werden.

Knappheit der Güter resultiert daraus, dass die menschlichen Bedürfnisse bzw. Wünsche größer sind als die frei in der Natur verfügbaren Güter. Die Antwort der Menschen auf die Knappheit ist die unter Einsatz von Produktionsfaktoren gezielte Vermehrung der knappen Güter.
Читать дальше
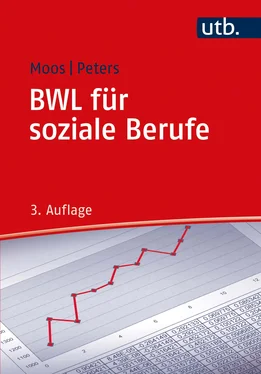


 die natürlichen Ressourcen, oft verkürzt als Boden bezeichnet
die natürlichen Ressourcen, oft verkürzt als Boden bezeichnet