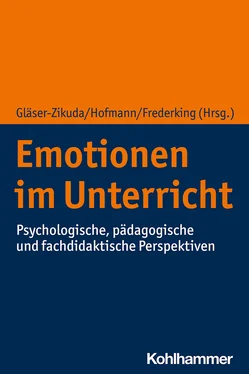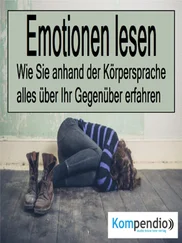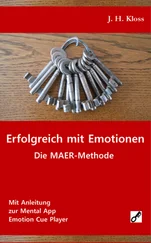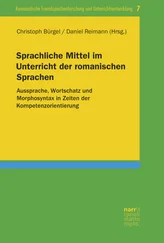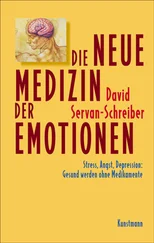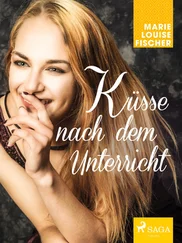Emotionen im Unterricht
Здесь есть возможность читать онлайн «Emotionen im Unterricht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Emotionen im Unterricht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Emotionen im Unterricht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Emotionen im Unterricht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Emotionen im Unterricht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Emotionen im Unterricht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Als Besonderheit ist zunächst zu vermerken, dass die Philosophie (von griech. philos (= Liebe) und sophia (= Weisheit)) mit der »Liebe« zur Weisheit sogar eine Emotion und ihren fachspezifischen Zielpunkt im Namen trägt – und dies als Wissenschaft, die wie kaum eine andere Vernunft und Rationalität als ihren disziplinären Kern versteht. Dabei werden personal-(selbst-)reflexive und funktional-erkenntnisorientierte Aspekte gleichermaßen adressiert. Es geht um Selbsterkenntnis des die Weisheit Liebenden ebenso wie um Erkenntnis auf Gebieten wie Anthropologie, Ethik, Natur-, Religions- oder Erkenntnistheorie. Allerdings war in der Philosophie bis zum 19. Jahrhundert nicht der Emotionsbegriff leitend. In der griechischen Antike waren vielmehr hedoné und ponos (= Lust und Unlust) und das Wort páthos (= Leiden, Leidenschaft) verbreitet; dieses wurde später mit dem lateinischen Begriff affectus (Affekt, Leidenschaft) übersetzt. An den Positionen von Aristoteles und Spinoza lassen sich Besonderheiten des damit verbundenen klassischen philosophischen Verständnisses verdeutlichen.
Nach Aristoteles ist der Mensch durch Leidenschaften in seiner Freiheit bedroht und zwischen den beiden Polen ›Lust‹ und ›Unlust‹ (hedoné und ponos) hin- und hergerissen – eine Polarität, die auch in modernen psychologischen Ansätzen fortwirkt. Sittliches Leben hat nach Aristoteles die Überwindung dieses Zwiespalts zur Voraussetzung. Nur in der »Erhabenheit über die Begierden und die zügellose Genußsucht« (Aristoteles, 335–323 v. Chr., S. 152) kann das oberste Ziel menschlichen Lebens erreicht werden, »das glückselige Leben […] [als] Zustand der Freude« (ebd., S. 164). Voraussetzung von Glückseligkeit ist eine Ausbalancierung der Affekte durch die Orientierung an Tugenden. Glückseligkeit definiert Aristoteles entsprechend als »eine der vollendeten Tugend gemäße Tätigkeit der Seele« (ebd., S. 22). Tugend basiert auf der Überwindung der Herrschaft der Affekte durch eine ausbalancierte Mitte zwischen affektiven Extremen:
»Die Tugend ist ein Habitus des Wählens, der die […] Mitte hält und durch die Vernunft bestimmt wird […] [und] in den Affekten und Handlungen das Mittlere findet und wählt. Deshalb ist die Tugend nach ihrer Substanz und ihrem Wesensbegriff Mitte.« (ebd., S. 36)
Diese ethische Verortung der Affekte und die damit verbundenen Empfehlungen für eine affektive Balance als Grundlage eines glücklichen Lebens enthält für eine Theorie fachlich-emotionaler Bildung gerade in personal-selbstreflexiver Hinsicht wichtige Anknüpfungspunkte.
Gleiches gilt für die Ethik Baruch de Spinozas, in der die Aristotelische Sicht ausdifferenziert worden ist. Wertete Thomas Hobbes (1642–58, S. 32) Affekte noch als »Störungen des Geistes«, hat Spinoza (1677) einen dem Rationalismus verpflichteten, aber gleichwohl die Affekte als »Leidenschaften« ernst nehmenden Versuch unternommen, zu einem differenzierteren Verständnis zu gelangen. Dabei unterschied er in der Aristotelischen Tradition drei Grundtypen: Begierde, Lust oder Unlust. Diese haben unmittelbare ethische Implikationen: »Die Erkenntnis des Guten und Schlechten« entspricht dem Wissen über die Affekte ›Lust‹ oder ›Unlust‹ (ebd., S. 266). Diesen ordnete er 50 weitere Affekte, affektive Reaktionen bzw. affektive Haltungen zu und erläuterte ihre jeweiligen Besonderheiten: u. a. Bewunderung, Verachtung, Liebe, Hass, Zuneigung, Abneigung, Ergebenheit, Verhöhnung (Spott), Hoffnung, Furcht, Zuversicht, Verzweiflung, Freude, Gewissensbiss, Mitleid, Gunst, Entrüstung, Überschätzung, Unterschätzung, Missgunst, Mitgefühl (Barmherzigkeit), Selbstzufriedenheit, Niedergeschlagenheit, Reue, Hochmut (Stolz), Kleinmut, Ehre (Ehrfreude), Scham, Sehnsucht, Wetteifer, Dankbarkeit, Wohlwollen, Zorn, Rachsucht, Wut, Scheu, Kühnheit, Ängstlichkeit, Bestürzung, Leutseligkeit, Ehrgeiz, Schwelgerei, Trunksucht, Habsucht (Geiz), Lüsternheit (ebd., S. 155 ff.).
Mit der Affektlehre Spinozas ist ein Differenzierungsgrad innerhalb der abendländischen Philosophie zu Affekten bzw. Emotionen erreicht worden, der seinesgleichen sucht und vorwegnimmt, was moderne psychologische Forschungen anstreben – eine Systematik von Affekten bzw. Emotionen. Noch bedeutsamer ist aus fachdidaktischer Sicht aber die ethische Rahmung. Nicht die Expression der Affekte ist nach Spinoza nämlich oberstes Ziel, sondern der richtige Umgang mit ihnen. Wie bei Aristoteles führen negative Affekte nach Spinoza zur Unfreiheit (ebd., S. 254 ff.), sie können den Menschen versklaven, nur die Vernunft führt den Menschen zu Freiheit (ebd., S. 352 ff.). Zusammen mit der Liebe, in der alle Affekte als höchste ›Lust‹ ihren Ziel- und Bezugspunkt finden (ebd., S. 234), ist ein ausbalancierter Umgang mit den Affekten möglich. In Spinozas Systematik finden sich mithin Ansätze zu einer Ethik der Emotionen (vgl. Renz, 2008, S. 311 f.), in der eine fachdidaktische Theorie emotionalen Gleichgewichts als ein Kernelement fachlicher Bildung mit personalem wie funktionalem Fokus wichtige Anregungen und Orientierungspunkte finden kann.
Gleiches gilt für neuzeitliche Positionen wie Blaise Pascals Idee einer Vernunft des Herzens (1669), Schellings Bestimmung der Liebe als höchster Kraft (1809), Arthur Schopenhauers Ethik des Mitleids (1839), Erich Fromms (1956) Kunst des Liebens oder Max Schelers (1955) Verbindung von Liebe und Erkenntnis. Während diese Ansätze allerdings eher Ausnahmen im rational geprägten Gesamtspektrum der Philosophiegeschichte der Neuzeit darstellen, finden sich in der Ende des 20. Jahrhunderts einsetzenden intensivierten philosophischen Auseinandersetzung mit Affekten, Gefühlen bzw. Emotionen weitere interessante und aktuelle Anknüpfungspunkte für eine fachdidaktische Emotionstheorie. Wenn Peter Bieri (1994) Emotionen als Bewusstseinsphänomene ausweist, Jon Elster den Zusammenhang von ›rationality and the emotions‹ (1996) untersucht, Peter Goldie Emotionen philosophisch analysiert (2002), Martha Nussbaum »the intelligence of emotions« (2003) reflektiert, Rainer Schilling (2004) Liebe als Erkenntnisweise ausweist, Christoph Demmerling und Hilge Landweer (2007) sowie Sabine Döring (2009) Besonderheiten einer Philosophie der Gefühle konturieren, Ernst Tugendhat (2006) Grundlagen einer Ethik des Wohlwollens und der Herzensgüte erarbeitet oder Julian Nida-Rümelin (2012) die Bedeutung von Emotionen im Rahmen einer Philosophie der Bildung betont, zeigen sich darin jeweils beachtenswerte Ansätze, die Ausblendung der Emotionen in der Philosophie der Neuzeit zu überwinden und emotionale Grundlagen allgemeiner wie fachbezogener Bildungsprozesse philosophisch neu zu reflektieren. Eine philosophisch fundierte Ethik der Emotionen und des emotionalen Gleichgewichts kann ein zentraler Baustein für eine Theorie fachlicher Bildung und fachdidaktischer Bildungsforschung sein.
3.3.2 Fachlich kodierte bzw. intendierte Emotionen im fachdidaktischen Blick
Fachdidaktische Forschungen zu Emotionen, die fachlich kodiert bzw. teilweise intendiert sind, nehmen die Frage in den Blick, in welchen Kontexten Emotionen als Teil des fachspezifischen Gegenstandes bzw. Forschungsfeldes in Erscheinung treten. Wie dies geschieht bzw. geschehen kann und welche fachlichen Bildungsziele damit verknüpft sind, soll am Beispiel der im vorliegenden Band enthaltenen Forschungsübersichten veranschaulicht werden, in denen fachlich kodierte bzw. intendierte Emotionen behandelt wurden. Zunächst rücken mit Geographie, Geschichte und Religion jene Fachdidaktiken in den Fokus, in denen dies mit theoretischem Schwerpunkt geschehen ist. Mit Sportpädagogik und Deutschdidaktik folgen anschließend jene beiden Fachdidaktiken, in denen auch empirische Zugänge verstärkt genutzt werden, wie die Fachdarstellungen zeigen.
Für die Objektseite von Emotionen ist aus geographiedidaktischer Perspektive die mit Alexander von Humboldt verbundene Vorstellung zentral, »dass Geographie nicht nur objektiv feststellende Naturwissenschaft ist, sondern auch sinnlich-ästhetischer Zugänge bedarf, um den Raum als Ganzes zu erkennen«, wie Jan Schubert und Romy Hofmann in ihrem Beitrag aufzeigen (  Kap. 11). Es ist mithin die Wahrnehmung des Raumes als ästhetisches Phänomen, mit der Emotionen zu einem zentralen Element geographischer Bildung in einem reflexiv-personalen Sinne werden und erklären, warum geographiedidaktische Forschung eine besondere Offenheit für personale Aspekte fachlicher Bildung besitzt. Die für den Geographieunterricht zentrale Unterscheidung von vier Raumbegriffen – Raum 1. als »Wirkungsgefüge natürlicher und anthropogener Faktoren«, 2. »als System von Lagebeziehungen«, 3. »in der Wahrnehmung unterschiedlicher Akteure und 4. als gesellschaftliche Konstrukte« (ebd.) – macht nämlich deutlich: Während die ersten beiden Aspekte eher dem Aufbau von geographischem Weltwissen in einem funktionalen Sinne dienen, stellen die beiden letztgenannten Aspekte einen Konnex zwischen Raum und subjektiver Wahrnehmung her. Dies schließt Emotionen ein. Durch den Wahrnehmungsaspekt besitzt geographische Emotionsforschung deshalb auch auf der Objektseite einen personal-(selbst-)reflexiven und Emotionen als Phänomen adressierenden Fokus.
Kap. 11). Es ist mithin die Wahrnehmung des Raumes als ästhetisches Phänomen, mit der Emotionen zu einem zentralen Element geographischer Bildung in einem reflexiv-personalen Sinne werden und erklären, warum geographiedidaktische Forschung eine besondere Offenheit für personale Aspekte fachlicher Bildung besitzt. Die für den Geographieunterricht zentrale Unterscheidung von vier Raumbegriffen – Raum 1. als »Wirkungsgefüge natürlicher und anthropogener Faktoren«, 2. »als System von Lagebeziehungen«, 3. »in der Wahrnehmung unterschiedlicher Akteure und 4. als gesellschaftliche Konstrukte« (ebd.) – macht nämlich deutlich: Während die ersten beiden Aspekte eher dem Aufbau von geographischem Weltwissen in einem funktionalen Sinne dienen, stellen die beiden letztgenannten Aspekte einen Konnex zwischen Raum und subjektiver Wahrnehmung her. Dies schließt Emotionen ein. Durch den Wahrnehmungsaspekt besitzt geographische Emotionsforschung deshalb auch auf der Objektseite einen personal-(selbst-)reflexiven und Emotionen als Phänomen adressierenden Fokus.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Emotionen im Unterricht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Emotionen im Unterricht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Emotionen im Unterricht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.