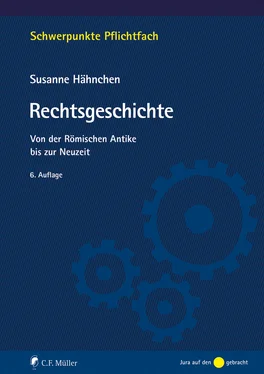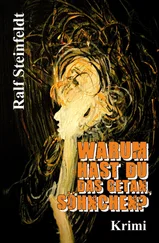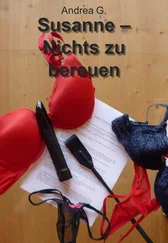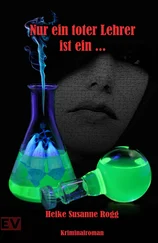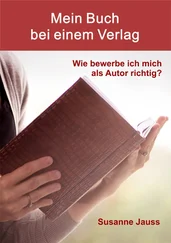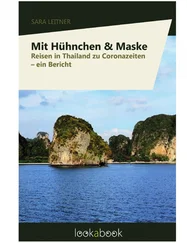83
Die Quästoren, die rangniedrigsten Magistrate in der Ämterlaufbahn, ausgestattet mit potestas , waren die Verwalter der Staatskasse und des Staatsarchivs.
84
Die Volkstribune hatten die Befugnis, gegen die coercitio der Imperiumsträger zu interzedieren ( Rn. 79 f), die Versammlung der Plebs ( Rn. 93) einzuberufen sowie dort Anträge zu stellen. Sie nahmen an den Senatssitzungen teil und wurden (erst) ab 102 v. Chr. wie andere ehemalige Amtsträger auch Senatoren. Als ursprüngliche Vertreter des einfachen Volkes im Ständekampf ( Rn. 46), gehörten sie später derselben sozialen Schicht an wie die Magistrate und vertraten dementsprechend die politische Linie des Senats.
85
Ein außergewöhnliches Amt (magistratus extraordinarius) stellte die Diktatur dar. Der Diktator wurde für eine Dauer von bis zu 6 Monaten eingesetzt, zunächst für sakrale Aufgaben, später auf der Grundlage eines Senatsbeschlusses durch einen Konsulartribunen (Militärtribun mit konsularischer Gewalt) oder Konsul. Es handelte sich um ein institutionalisiertes, legitimes Amt zur Bewältigung von Staatskrisen, das vor allem im 4. Jh., aber auch in den ersten beiden punischen Kriegen genutzt wurde. Hierfür wurde das Prinzip der Kollegialität durchbrochen, um ein zügiges Handeln zu ermöglichen. Gleichzeitig war der Diktator immun; er konnte wegen Fehlentscheidungen – anders als andere Magistrate, die nur während ihrer Amtszeit immun waren – auch nicht nachträglich zur Verantwortung gezogen werden. Ursprünglich frei von der Intervention der Volkstribune und der Provokation wurde er ihnen nach dem Ende des zweiten punischen Krieges doch unterworfen. Damit entfiel seine besondere Machtbefugnis, und an Stelle der Diktatur operierte der Senat künftig mit einer Art Notstandsgesetz, dem senatus consultum ultimum ( Rn. 87). Erst mit Sulla lebte das Amt am Ende der Republik wieder auf ( Rn. 98).
86
Die Proprätoren und Prokonsuln waren in ihren Provinzen uneingeschränkte Alleinherrscher, faktisch allerdings dem Senat verantwortlich. Sie hatten keine interzessionsberechtigten Kollegen. In den Provinzen gab es auch keine provocatio an eine Volksversammlung. Die Provinzialstatthalter standen u. a. dem römischen Gerichtswesen ihrer Provinz vor, ähnlich den Prätoren in Rom. Für die nichtrömischen Einwohner blieben aber auch die Gerichte ihrer unter der Römerherrschaft fortbestehenden Gemeinwesen ( Rn. 76) erhalten.
87
Im Senat war in der Republik die politische und gesellschaftliche Führungsschicht Roms versammelt. Er existierte wahrscheinlich schon in der Königszeit, als Versammlung der patrizischen Häupter. Seine Macht beruhte darauf, dass man – anders als bei den einzelnen Ämtern – einen Sitz im Senat auf Lebenszeit, also dauerhaft hatte. In den Senat gelangte man durch die lectio senatus der Zensoren ( Rn. 81). Lange wurden nur ehemalige Konsuln und Prätoren Senatoren. Ab ca. 100 v. Chr. kamen auch Volkstribune, Ädile und Quästoren hinzu.
Die Senatsbeschlüsse (Singular: senatus consultum , Plural: senatus consulta ) hatten ursprünglich nur beratende Funktion für die amtierenden Beamten, wurden später jedoch als eigenständige Rechtsquelle ( Rn. 139) angesehen.[3] Tatsächlich beherrschte der Senat die Außenpolitik, entschied über Krieg und Frieden, Staatshaushalt, Rüstung, die Verteilung des militärischen Kommandos unter den Konsuln und die Besetzung der Statthalterposten in den Provinzen. Selbst Beschlüsse der Komitien unterlagen der Bestätigung durch den Senat ( auctoritas patrum oder auctoritas senatus ).
Ein rechtlich umstrittenes Mittel, eine Art Notstandsdiktatur zu errichten, stellte das senatus consultum ultimum (s.c. de re publica defendenda) dar: videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat , d.h. die Konsuln mögen dafür sorgen, dass der Staat keinen Nachteil erleidet. Es verschaffte den Konsuln nach Auffassung der Senatskreise unbeschränkte Befugnisse und spielte in der letzten Phase der Republik eine große Rolle ( Rn. 96, 100, 102).
4. Die Volksversammlungen
88
Es gab verschiedene Einteilungen, nach denen das römische Volk sich versammelte; eine davon erfolgte nach Kurien ( Rn. 41, 43). Die Kuriatkomitien hatten aber wohl nie politische Entscheidungsbefugnisse. Ihre Funktionen waren vor allem sakraler Natur. Die von ihnen den Imperiumsträgern (Konsuln, Prätoren) erteilte Bestätigung (lex curiata de imperio) war politisch eine bloße Formalität.
89
Am wichtigsten waren die Zenturiatkomitien ( Rn. 43), in denen die männlichen römischen Bürger in Hundertschaften (Zenturien) eingeteilt waren. Tatsächlich geschah die Zuweisung durch die Zensoren entsprechend dem Einkommen, der Klasse und eine Zenturie war zahlenmäßig nicht beschränkt. Es gab
| 18 |
Ritterzenturien (Reiter), |
| 80 |
Zenturien der 1. Klasse (Hopliten), |
| 90 |
Zenturien Leichtbewaffnete, |
| 4 |
Zenturien Handwerker und Musikanten, |
| 1 |
Zenturie der vermögenslosen proletarii (infra classem) , die nicht im Heer dienten. |
Insgesamt waren es 193 Zenturien. Es wurde zunächst in den einzelnen Zenturien abgestimmt, wobei die einfache Mehrheit entschied. Das Ergebnis gab vor, wie die Zenturie insgesamt abstimmte. Wenn die Ritterzenturien und die der ersten Einkommensklasse sich einig waren, hatten sie zusammen bereits die Mehrheit. Die Stimmen der Reichen in Einheiten mit wenigen Mitgliedern hatten also weitaus mehr Gewicht als die der Ärmeren in den kopfstarken Zenturien (timokratisches Prinzip). Die Zenturien versammelten sich auf dem Marsfeld (im Tiberbogen, heute Innenstadt Roms).
Die Zenturiatkomitien waren zuständig für die Wahl der Konsuln, Prätoren und Zensoren, für die Verabschiedung von Volksgesetzen auf Antrag der Konsuln und Prätoren sowie die Entscheidung über Strafanträge dieser Imperiumsträger und die provocatio ad populum ( Rn. 79). Aus dieser Anrufung des Volkes gegen die Gewalt der Imperiumsträger entwickelte sich der Strafprozess vor den Zenturiatkomitien. Außerdem gab es Sondergerichte für Strafverfahren, die von Fall zu Fall eingerichtet wurden ( quaestiones extraordinariae , Rn. 560).
90
Unpolitische Alltagskriminalität hingegen wurde seit dem 3. Jahrhundert von einem Kollegium dreier prätorischer Hilfsbeamter (tresviri capitales) geahndet. Sie übten eine Polizeijustiz aus bei Tötung, Brandstiftung, Waffenansammlung und Giftmischerei in krimineller Absicht, aber auch bei Diebstählen.
91
In der Volksversammlung wurde nur abgestimmt. Der einzelne Bürger hatte kein Recht, Anträge zu stellen. Das Recht der Initiative lag vielmehr nur bei den Magistraten (Konsuln und Prätoren in den Zenturiatkomitien). Für Beratungen und Diskussionsreden waren Vor-Versammlungen zuständig.
Die Abstimmung über Gesetze und Verurteilungen in den Zenturiatkomitien erfolgte zunächst mündlich, ab 139 v. Chr. mit Tontäfelchen. Zuerst wurde die Mehrheit innerhalb der Zenturien ermittelt. Die Abstimmung hörte auf, sobald sich eine Mehrheit der Zenturien für oder gegen einen Antrag entschieden hatte.
Bei Wahlen schrieb der Abstimmende den Namen des Kandidaten auf ein Täfelchen; hier entschied die absolute Mehrheit.
92
Aufgrund der Einteilung nach Stämmen ( Rn. 41, 43) versammelte sich das Volk auch in Tribuskomitien. Hier wurden die kurulischen Ädilen und die Quästoren gewählt. Gesetzgebung durch die Tribuskomitien war hingegen selten. 220 v. Chr. legte man die Zahl auf 4 städtische und 31 ländliche Tribus fest. In den ländlichen Tribus waren die Vornehmen, vor allem die Großgrundbesitzer eingeschrieben (durch die Zensoren), das gewöhnliche Volk in den kopfstarken städtischen Tribus. Neubürger und Freigelassene kamen ebenfalls in die städtischen Tribus. Einberufen wurden die Tribuskomitien durch die Höchstmagistrate.
Читать дальше