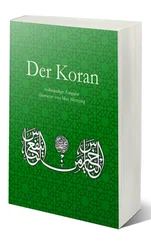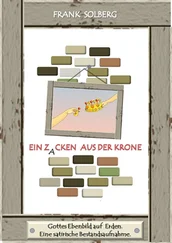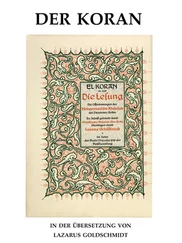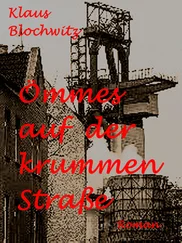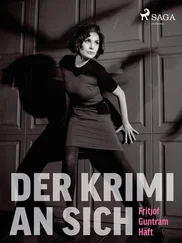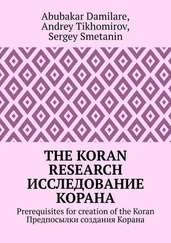Für die theologische und religionspädagogische Interpretation stehen heute hermeneutische Fragen im Vordergrund, die nicht von der Entstehungsgeschichte und den soziokulturellen Kontexten des Textes zu trennen sind. Von daher ist die Bezugsetzung zu gegenwärtigen Lebensumständen überhaupt erst die Voraussetzung, den Koran zu verstehen und ihm als Text gerecht zu werden. Die Frage ist, wie dabei vorgegangen wird. Es ist kaum zu bestreiten, dass der Text reflektiert, was zu den Lebensumständen und zum Weltbild jener gehörte, in deren Mitte er entstand: Die Rede ist demnach vom 7. Jahrhundert nach christlicher Zeitrechnung und vom kulturgeografischen Raum des Hedschas, des südwestlichen Teils der arabischen Halbinsel sowie von den weiteren kulturellen Einflusssphären Syrien, Persien, Jemen und Ostafrika. In dieser Hinsicht erschließt sich der Koran zunächst als ein historisches und in gewisser Weise auch exotisches Diskursdokument.
Wer sich indes vom Koran ansprechen lässt, dem erschließt sich die Tiefe unter der Oberfläche des Textes. Gemeint ist mehr als nur das Lesen zwischen den Zeilen, mit dem der Koran selbst kokettiert; es geht vielmehr um die Genese von überzeitlichem Sinn als einer Leistung des lesenden Subjekts. Zum zeitgebundenen Gerüst des Textinhalts, dem Trägermilieu sozusagen, tritt der eigentliche Textgehalt in seiner zeitlosen und universalen Dimension hinzu. Die Kunst der Hermeneutik besteht nun darin, diese beiden Aspekte zueinander in Korrespondenz zu stellen und nicht gegeneinander auszuspielen. Mit dem lesenden Leser, durch den also der Koran überhaupt erst zum Koran im eigentlichen Sinne wird, treten zudem die rationalen und relationalen Merkmale seiner Person auf den Plan, die kulturräumlichen Spezifika, die eigene kognitive Karte, die relative Nähe oder Distanz zur arabischen Sprache sowie spirituelle und ästhetische Momente. All dies sind Ebenen, auf denen es zur „Passung“ zwischen Text, Lesendem und Welt kommt. Damit scheint der Koran über die Dimension seiner Historizität in der Dimension der Aktualität auf: Der Koran wird nicht nur erlesen, sondern erlebt.
Wie weit darf die Koranexegese gehen, wenn man bedenkt, dass der Koran das originalgetreu überlieferte Wort Gottes ist?
Die meisten Muslime, die dem Verfasser persönlich bekannt sind, und das sind viele, würden vermutlich dem Satz zustimmen, dass der Koran das von Gott wortwörtlich offenbarte Wort sei. Auch der Verfasser schließt sich dem aus Gründen an, die er, wenn danach gefragt, in seinem Kopf und in seinem Herzen suchen würde. Allerdings kommt es immer wieder zum Dissens zwischen dem Verfasser und seinen frommen Schwestern und Brüdern, wie ein solcher Satz zu verstehen sei und welche Konsequenzen das für die Hermeneutik habe, die sich immer im Spannungsfeld zwischen Literalität und dekonstruktivistischer Werkinterpretation bewegt – im theologischen Zugriff auf die Schrift zumal (vertiefend Derrida 2003).
Die muslimische Zurückhaltung gegenüber dem Koran als Text, was das betrifft, speist sich manchmal eher aus einem kulturell bedingten, aber auch durch das arabische Judentum und seinen Umgang mit der Schrift beeinflussten Habitus des Respekts. Daran, und zwar insbesondere an der kultischen Selbstbeschränkung gegenüber der Schrift, wäre nichts auszusetzen, wenn das nicht Hand in Hand gehen würde mit der unbotmäßigen Restriktion gegenüber der intellektuellen Auseinandersetzung mit ihren Inhalten – dies nun eher ein muslimisches und weniger eine jüdisches Phänomen. Über die Verhältnisbestimmung von Verstand und Glaube mit Blick auf den Koran kam es schon zwischen dem 8. Und 10. Jahrhundert n. Chr. zwischen verschiedenen theologischen Schulen in Basra zum Streit, vor allem über die Grundsatzfrage, wer für wen da sei: der Mensch für den Islam oder der Islam für den Menschen. Dieser tektonische Bruch zieht sich noch bis heute durch islamische Denkwelten.
Der Koran selbst legt den Zuhörern und Lesern interessanterweise keine Grenzen für die Auslegung auf, sondern er ruft im Gegenteil dazu auf, ihn zu „packen“ (19:12), ihn nach allen Regeln der Kunst ( hikma ;  ) auseinanderzunehmen und sich an ihm abzuarbeiten (vgl. 4:81-82), um durch ihn Urteilskraft ( hukm ;
) auseinanderzunehmen und sich an ihm abzuarbeiten (vgl. 4:81-82), um durch ihn Urteilskraft ( hukm ;  ) zu erlangen. Nach allen Regeln der Kunst, wohlgemerkt, zu der nicht gehört, den Text mutwillig zu missbrauchen – vielleicht die einzige Grenze, die der Text vor allem mit Blick auf die Nutzer zieht, wenn er in 7:3 vor dem Missbrauch warnt. Das Problem mit der Exegese liegt also nicht beim Text, sondern bei den Menschen und ihren Motiven. Hier möchte sich der Verfasser mit einem Zitat seiner geschätzten Kollegin Ulrike Bechmann aus der katholischen Theologie anschließen; was sie für die Bibel auf den Punkt bringt, gilt uneingeschränkt auch für den Umgang mit dem Koran: „Die Frage bleibt: Kann man aus der Bibel alles herauslesen? Lässt sich Gewalttat mit Recht genau so „gut“ rechtfertigen wie eine befreiende Theologie? Woher kommen die „richtigen“ Prioritäten und Perspektiven und wer setzt sie durch? Wer sagt, dass Gnade vor Gesetz geht, Gerechtigkeit vor Vergeltung, Versöhnung vor Rache, Gewaltlosigkeit vor Gewalt? Alles hängt davon ab, in welchem Geist die Menschen die Bibel lesen. Und dies ist von dem Geist abhängig, den sie nach innen und außen leben. Auslegungen, die Gewalt und Unterdrückung fördern, haben eine böse Attraktivität. Damit sie nicht wirksam sind, müssen sich Gläubige zu Gunsten von mehr Menschlichkeit und Freiheit gegenseitig unterstützen und kritisieren. Letztlich müssen wir hoffen, dass Gott uns in den Arm fällt, wenn wir dabei sind, sein Wort zu pervertieren“ (Bechmann 2005).
) zu erlangen. Nach allen Regeln der Kunst, wohlgemerkt, zu der nicht gehört, den Text mutwillig zu missbrauchen – vielleicht die einzige Grenze, die der Text vor allem mit Blick auf die Nutzer zieht, wenn er in 7:3 vor dem Missbrauch warnt. Das Problem mit der Exegese liegt also nicht beim Text, sondern bei den Menschen und ihren Motiven. Hier möchte sich der Verfasser mit einem Zitat seiner geschätzten Kollegin Ulrike Bechmann aus der katholischen Theologie anschließen; was sie für die Bibel auf den Punkt bringt, gilt uneingeschränkt auch für den Umgang mit dem Koran: „Die Frage bleibt: Kann man aus der Bibel alles herauslesen? Lässt sich Gewalttat mit Recht genau so „gut“ rechtfertigen wie eine befreiende Theologie? Woher kommen die „richtigen“ Prioritäten und Perspektiven und wer setzt sie durch? Wer sagt, dass Gnade vor Gesetz geht, Gerechtigkeit vor Vergeltung, Versöhnung vor Rache, Gewaltlosigkeit vor Gewalt? Alles hängt davon ab, in welchem Geist die Menschen die Bibel lesen. Und dies ist von dem Geist abhängig, den sie nach innen und außen leben. Auslegungen, die Gewalt und Unterdrückung fördern, haben eine böse Attraktivität. Damit sie nicht wirksam sind, müssen sich Gläubige zu Gunsten von mehr Menschlichkeit und Freiheit gegenseitig unterstützen und kritisieren. Letztlich müssen wir hoffen, dass Gott uns in den Arm fällt, wenn wir dabei sind, sein Wort zu pervertieren“ (Bechmann 2005).
Welche konkreten Lehren kann man heute aus dem Koran ziehen? Was ist die zentrale Botschaft dieses Buches?
Zur zentralen Botschaft des Korans gehört, was auch zur Mitte des Islams als Religion und Lebensweise geronnen ist. In einem Satz zusammengefasst etwa so: Die Menschen schlafen, und wenn sie sterben, erwachen sie. Dieser Satz wird in der Tradition cAli bin Abi Talib zugeschrieben, der als junger Mann bei Muhammad aufwuchs und später, nach dem Tode Muhammads an vierter Stelle der nachfolgenden Kalifen stand. Damit geraten einige Aspekte in den Fokus, die der Koran in wiederkehrenden Geschichten, Gleichnissen, thematischer Rede, Anrede und Gebeten thematisiert – allen voran: Der Mensch ist nicht allein, sondern von Gott befristet in die Welt und somit in die Freiheit entlassen, verbunden mit der Ankündigung der Rückkehr. In dieser Spannung zwischen Bindung und Freiheit gründet die bedingte Verantwortbarkeit und Rechenschaftspflicht des Menschen gegenüber Gott – und damit die Mühe, sich nach bestem Wissen und Gewissen zwischen Gut und Böse entscheiden zu müssen. Mithin gehört zu den Themen des Korans auch die Verhältnisbestimmung von Gnade und Gerechtigkeit.
Der Koran bietet an, als Moslem zu leben, was bedeutet, einen bestimmten Weg zu gehen, der sich von anderen unterscheidet (vgl. 6:161ff.; Behr 2010). In dieser Hinsicht versteht sich der Islam weniger als Ding an sich sondern eher als Mittel zum Zweck. Es geht um „Verbesserung“ ( tazkiyya ;  ), „Veredelung“ ( kamāl ;
), „Veredelung“ ( kamāl ;  ) oder „Verschönerung“ ( islāh ;
) oder „Verschönerung“ ( islāh ;  ) des Lebens in seiner religiösen Dimension und als Korrektiv gegenüber den drei geerdeten Kategorien des Lebens: die materielle Versorgung, die Sicherheit und das Wachstum (vgl. Behr 2008). Mit Blick auf die globalen Prozesse der Zerstörung, die solcherlei Dreieinigkeit hervorruft, gewinnt die altprophetische Herrschaftskritik des Korans neue Aktualität. Hier erschließt sich dem Verfasser eine interessante interreligiöse: Muhammad ordnete an, ein Fünftel des Gewinns aus Bodenschätzen sozialen Zwecken zuzuführen. Wer sagt's den Bonzen?
) des Lebens in seiner religiösen Dimension und als Korrektiv gegenüber den drei geerdeten Kategorien des Lebens: die materielle Versorgung, die Sicherheit und das Wachstum (vgl. Behr 2008). Mit Blick auf die globalen Prozesse der Zerstörung, die solcherlei Dreieinigkeit hervorruft, gewinnt die altprophetische Herrschaftskritik des Korans neue Aktualität. Hier erschließt sich dem Verfasser eine interessante interreligiöse: Muhammad ordnete an, ein Fünftel des Gewinns aus Bodenschätzen sozialen Zwecken zuzuführen. Wer sagt's den Bonzen?
Читать дальше
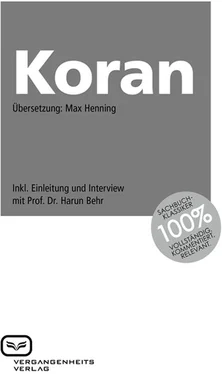
 ) auseinanderzunehmen und sich an ihm abzuarbeiten (vgl. 4:81-82), um durch ihn Urteilskraft ( hukm ;
) auseinanderzunehmen und sich an ihm abzuarbeiten (vgl. 4:81-82), um durch ihn Urteilskraft ( hukm ;  ) zu erlangen. Nach allen Regeln der Kunst, wohlgemerkt, zu der nicht gehört, den Text mutwillig zu missbrauchen – vielleicht die einzige Grenze, die der Text vor allem mit Blick auf die Nutzer zieht, wenn er in 7:3 vor dem Missbrauch warnt. Das Problem mit der Exegese liegt also nicht beim Text, sondern bei den Menschen und ihren Motiven. Hier möchte sich der Verfasser mit einem Zitat seiner geschätzten Kollegin Ulrike Bechmann aus der katholischen Theologie anschließen; was sie für die Bibel auf den Punkt bringt, gilt uneingeschränkt auch für den Umgang mit dem Koran: „Die Frage bleibt: Kann man aus der Bibel alles herauslesen? Lässt sich Gewalttat mit Recht genau so „gut“ rechtfertigen wie eine befreiende Theologie? Woher kommen die „richtigen“ Prioritäten und Perspektiven und wer setzt sie durch? Wer sagt, dass Gnade vor Gesetz geht, Gerechtigkeit vor Vergeltung, Versöhnung vor Rache, Gewaltlosigkeit vor Gewalt? Alles hängt davon ab, in welchem Geist die Menschen die Bibel lesen. Und dies ist von dem Geist abhängig, den sie nach innen und außen leben. Auslegungen, die Gewalt und Unterdrückung fördern, haben eine böse Attraktivität. Damit sie nicht wirksam sind, müssen sich Gläubige zu Gunsten von mehr Menschlichkeit und Freiheit gegenseitig unterstützen und kritisieren. Letztlich müssen wir hoffen, dass Gott uns in den Arm fällt, wenn wir dabei sind, sein Wort zu pervertieren“ (Bechmann 2005).
) zu erlangen. Nach allen Regeln der Kunst, wohlgemerkt, zu der nicht gehört, den Text mutwillig zu missbrauchen – vielleicht die einzige Grenze, die der Text vor allem mit Blick auf die Nutzer zieht, wenn er in 7:3 vor dem Missbrauch warnt. Das Problem mit der Exegese liegt also nicht beim Text, sondern bei den Menschen und ihren Motiven. Hier möchte sich der Verfasser mit einem Zitat seiner geschätzten Kollegin Ulrike Bechmann aus der katholischen Theologie anschließen; was sie für die Bibel auf den Punkt bringt, gilt uneingeschränkt auch für den Umgang mit dem Koran: „Die Frage bleibt: Kann man aus der Bibel alles herauslesen? Lässt sich Gewalttat mit Recht genau so „gut“ rechtfertigen wie eine befreiende Theologie? Woher kommen die „richtigen“ Prioritäten und Perspektiven und wer setzt sie durch? Wer sagt, dass Gnade vor Gesetz geht, Gerechtigkeit vor Vergeltung, Versöhnung vor Rache, Gewaltlosigkeit vor Gewalt? Alles hängt davon ab, in welchem Geist die Menschen die Bibel lesen. Und dies ist von dem Geist abhängig, den sie nach innen und außen leben. Auslegungen, die Gewalt und Unterdrückung fördern, haben eine böse Attraktivität. Damit sie nicht wirksam sind, müssen sich Gläubige zu Gunsten von mehr Menschlichkeit und Freiheit gegenseitig unterstützen und kritisieren. Letztlich müssen wir hoffen, dass Gott uns in den Arm fällt, wenn wir dabei sind, sein Wort zu pervertieren“ (Bechmann 2005). ), „Veredelung“ ( kamāl ;
), „Veredelung“ ( kamāl ;  ) oder „Verschönerung“ ( islāh ;
) oder „Verschönerung“ ( islāh ;  ) des Lebens in seiner religiösen Dimension und als Korrektiv gegenüber den drei geerdeten Kategorien des Lebens: die materielle Versorgung, die Sicherheit und das Wachstum (vgl. Behr 2008). Mit Blick auf die globalen Prozesse der Zerstörung, die solcherlei Dreieinigkeit hervorruft, gewinnt die altprophetische Herrschaftskritik des Korans neue Aktualität. Hier erschließt sich dem Verfasser eine interessante interreligiöse: Muhammad ordnete an, ein Fünftel des Gewinns aus Bodenschätzen sozialen Zwecken zuzuführen. Wer sagt's den Bonzen?
) des Lebens in seiner religiösen Dimension und als Korrektiv gegenüber den drei geerdeten Kategorien des Lebens: die materielle Versorgung, die Sicherheit und das Wachstum (vgl. Behr 2008). Mit Blick auf die globalen Prozesse der Zerstörung, die solcherlei Dreieinigkeit hervorruft, gewinnt die altprophetische Herrschaftskritik des Korans neue Aktualität. Hier erschließt sich dem Verfasser eine interessante interreligiöse: Muhammad ordnete an, ein Fünftel des Gewinns aus Bodenschätzen sozialen Zwecken zuzuführen. Wer sagt's den Bonzen?