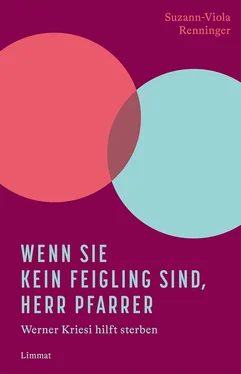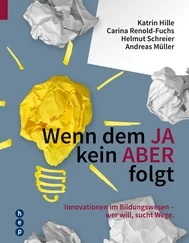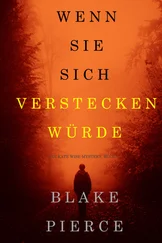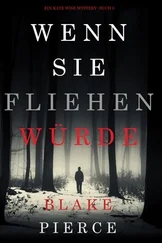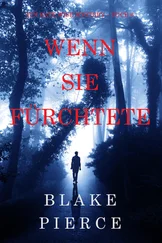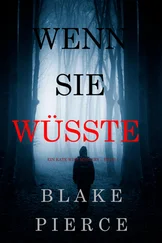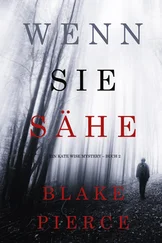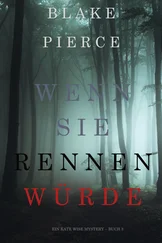Auch in der Schweiz setzen die Begrifflichkeiten klare Grenzen. Direkte aktive Sterbehilfe, die gezielte, vorsätzliche Verabreichung einer Spritze, die zum Tod führt, ist durch das Strafgesetzbuch verboten. Ich frage mich, ob es nicht nur eine Sache der Konsequenz, des Realismus und wohl auch Mutes ist, einen Schritt weiterzugehen und auch die direkte aktive Sterbehilfe, ungeachtet der höheren psychologischen Hürde auch hier, moralisch und rechtlich mit den anderen Formen der Sterbehilfe gleichzusetzen.
Die Grenzen sind in der Praxis ohnehin fließend. Das sagen gerade die Intensivmediziner, die Tag für Tag mit dieser Situation konfrontiert sind. Es gibt einen breiten Graubereich, in dem zwischen palliativer Sedierung und aktiver Sterbehilfe nur mit viel Haarspalterei zu unterscheiden ist. So habe ich oft von Medizinern gehört, dass sie auch das Einstellen einer lebenserhaltenden Maßnahme als eine aktive Handlung und so gesehen als aktive Sterbehilfe empfinden.
Anfänglich war ja die aktive Sterbehilfe auf Wunsch das Ziel der Gründer von Exit. Doch die Politik zog nicht mit, auch wenn die Volksabstimmung von 1977 eine breite Akzeptanz zumindest der Zürcher Stimmbürger zeigte. Exit nahm daher schon 1984, im zweiten Jahr nach der Gründung, von der aktiven Sterbehilfe Abstand und bietet seither ausschließlich etwas an, was bisher nicht diskutiert worden war: die Hilfe beim Freitod …
… bei der entscheidend ist, dass der Sterbewillige entweder eigenhändig das Sterbemittel trinkt oder eigenhändig den Infusionshahn öffnet. Und nicht Dritte. Weder Ärzte noch Angehörige.
Was ist, wenn ein Patient nicht mehr die Kraft oder Bewegungskontrolle dafür hat?
Hier müssen wir improvisieren, denn sonst eröffnet die Staatsanwaltschaft ein Verfahren. Einmal passierte es, dass die Finger eines Patienten an dem Tag, an dem er sterben wollte, nicht mehr beweglich genug waren, um den Infusionshahn zu bedienen. Also verbogen wir eine Büroklammer so, dass wir sie am Infusionshahn befestigen konnten. Dann verbanden wir sie mit einer Schnur, die wir dem Patienten in die Hand gaben. Er zog – das konnte er noch –, und der Hahn öffnete sich. Somit war es der Patient, nicht wir, der den letzten Akt vollzog, der dann zu seinem Sterben führte. Die Juristen nennen das Tatherrschaft.
Später habe ich diese Verfahren Dr. Brunner vorgeführt, dem damaligen Leitenden Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich. Wir trafen uns regelmäßig, um die Möglichkeiten von Exit auszuloten. Er stimmte zu, dass dieses Verfahren noch im Rahmen der Legalität sei. Doch er war äußerst vorsichtig und empfahl, zukünftig doch bitte zwei Büroklammern zu verwenden. Bei nur einer sei das Risiko zu groß, dass der Patient durch seine Nervosität den Hahn versehentlich öffne. Und ein Versehen ist keine Tatherrschaft. Seither verwenden wir in diesen Notsituationen also zwei Büroklammern.
Klingt nach rechter Trickserei. Was ist, wenn die zwei Büroklammern in einer solchen Situation zu viel Widerstand leisten? Wenn Sie dann eine wegnehmen und der Patient es nochmals versucht? Wiederum vergeblich? Wie gehen Sie dann mit der Tatherrschaft um?
Wenn etwa ein Patient mit einer degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems wie der amyotrophen Lateralsklerose die Fingerfertigkeit nicht mehr hat, dann können wir inzwischen riskieren, den Hahn für ihn zu öffnen aufgrund eines Gutachtens des Basler Juristen Daniel Häring. Er schreibt: «Über das ‹Ob› und ‹Wie› der Tat bestimmt ein Mensch beim Beizug einer professionellen Suizidhilfeorganisation auch dann, wenn er das zu seinem Tod führende Geschehen initiiert und durch klare Anweisungen an den Sterbehelfer, ohne dass diesem bei der Umsetzung ein großer Ermessensspielraum zukommt, vollständig selbst gestaltet.»18
Wissen Sie, all diese Unterscheidungen – passiv, indirekt aktiv, direkt aktiv, assistiert – sind Sprachwasch.
Sprachwasch?
Würden sie mich zu den älteren Leuten zählen?
Durchaus.
Das ist Sprachwasch.
Aha … Gut, dann zähle ich Sie zu den alten Männern. Auch wenn es mir recht unhöflich, geradezu respektlos vorkommt, so von Ihnen zu sprechen.
Sprechen Sie von mir als sehr altem Mann, bitte!
Okay. Ich versuch’s. Mal sehen. Und bald dann vom uralten Mann?
Ja, bald. Bald bin ich hochbetagt, hochaltrig, uralt. Aber erst, wenn ich neunzig bin.
Thomas von Aquin: Gott ist es, der tötet und lebendig macht
«Das Leben ist ein Geschenk Gottes und Gottes Macht unterworfen, der da tötet und lebendig macht», so schreibt Thomas von Aquin in seinem Hauptwerk «Summa theologica», zu Deutsch «Hauptinhalt der Theologie».19 In diesem voluminösen Werk nimmt er sich nichts anderes vor, als Anfängern, die die Lehre der katholischen Wahrheit nicht kennen, «kurz und klar» alles darzulegen, was zu dieser gehöre. Und somit auch das Selbstmordverbot von Augustinus.
Thomas von Aquin, in der Literatur meist abgekürzt Thomas genannt, wurde 1224 oder 1225 als jüngster Sohn des Grafen von Aquino wohl in der Burg Roccasecca geboren, die auf halbem Weg zwischen Rom und Neapel liegt. Fünf- oder sechsjährig übergeben ihn seine Eltern den Benediktinern des nahe gelegen Klosters Monte Cassino. Rund zehn Jahre später verlässt Thomas diesen Ort, um an der neu gegründeten Universität Neapel zu studieren. Bald darauf tritt er dem noch jungen Bettelorden der Dominikaner bei – in Abbildungen wird er daher meist im schwarzen Umhang dieses Ordens gezeigt. Es folgen lange Studienaufenthalte, erst in Paris, dann Köln und nochmals Paris, nun mit eigenen Lehrveranstaltungen. Das Studium, die Auseinandersetzung vor allem mit Aristoteles und dessen Kommentatoren empfindet er als «geistlichen Trost».20
Von Mitte 1272 bis Ende 1273 unterrichtet Thomas als Magister in Neapel, seinem letzten Lebens- und Wirkungsort. Er stirbt, erst 50-jährig, im Jahr 1274. Zeitgenossen spekulieren über einen politischen Giftmord. Seine «Summa theologica» bleibt unvollendet. In den kommenden beiden Jahrhunderten wird Thomas zu einer dominierenden Autorität, an der sich die katholische Kirche orientiert. Um daran keinen Zweifel aufkommen zu lassen, ernennt ihn Papst Pius V. in der Mitte des 16. Jahrhunderts zum Kirchenlehrer. Ende des 19. Jahrhunderts werden seine Lehren dann zur offiziellen Philosophie der katholischen Kirche erklärt.
Thomas war fromm, doch gleichzeitig ein analytischer Denker, der sich gegen die antiintellektuelle Haltung der Klöster stemmt. Religiöser Glaube und die logisch argumentierende Vernunft sind für ihn keine Konkurrenten, sondern zwei Wege, die widerspruchsfrei zu der einen Wahrheit führen. Doch dafür muss die Vernunft den richtigen Weg einschlagen. Und so stellt er in der «Summa» Frage um Frage, gibt darauf Antwort um Antwort, liefert Pro und Contra, zeigt, dass das Contra auf Fehlschlüssen der Vernunft beruht, auf unvollständigem, nachlässigem Denken, und stärkt, nein, zementiert so das Pro, auch bei der Frage: Darf jemand sich selber, aus eigener Autorität töten? Die Antwort ist ein dreifaches Nein.
Nein, weil die Selbsttötung dem Lebenszweck widerspricht. Denn ein jedes Wesen liebt von Natur aus sich selbst. Wer sich selbst tötet, verstößt gegen diese naturgegebene, heilige Selbstliebe.
Nein, weil jedes Wesen Teil eines Ganzen ist. Selbsttötung schadet der gesellschaftlichen Ordnung und tut ihr gegenüber somit ein Unrecht.
Nein, weil das Leben ein Geschenk Gottes und seiner Macht unterworfen ist. Denn «Gott allein gehört das Urteil über Leben und Tod». Wer Gott dieses Urteil streitig macht, beleidigt ihn und begeht eine Sünde. Thomas greift hier eine Stelle aus dem 5. Buch Mose auf, wo es heißt: «Seht nun, dass ich es bin und dass es keinen Gott gibt neben mir. Ich töte, und ich mache lebendig; ich habe zerschlagen, ich werde auch heilen, und niemand kann aus meiner Hand erretten.»21
Читать дальше