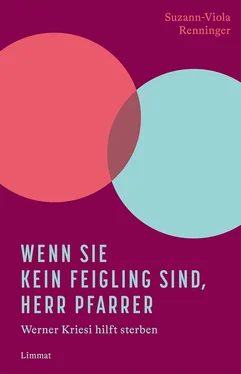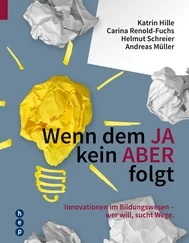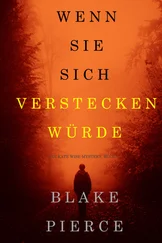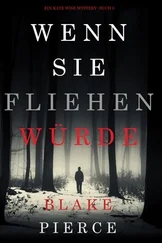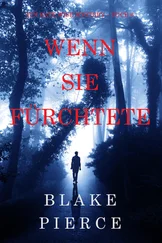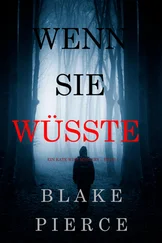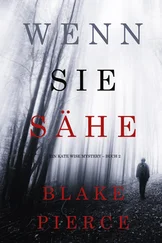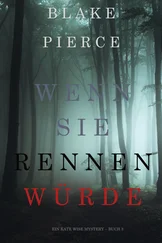Dieses dritte Argument ist das bis heute schwerwiegendste und einflussreichste. Denn da die Selbsttötung eine Sünde gegen Gott ist, sind die damit verbundenen Höllenstrafen die schwersten. Thomas schreibt: «Die gegen Gott sündigen, werden nicht nur gestraft, weil sie von der ewigen Glückseligkeit ausgeschlossen werden, sondern auch durch die Erfahrung von etwas Schmerzlichem.»22 Er übernimmt somit die Drohung aus dem Neuen Testament: «Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel!»23
Das Verbot, sich selbst zu töten, ist nur dann aufgehoben, wenn Gott den geheimen Befehl dazu gibt. Was offenbar nur selten passiert. Bei der Tötung eines anderen Menschen gibt Thomas mehr Spielraum. Gefragt, ob jemand töten darf, wenn er sich selbst verteidigen muss, antwortet er mit Ja. Denn hier sei die Absicht – die Rettung des eigenen Lebens – entscheidend und nicht, dass als Folge davon der Angreifer sein Leben verliere. Denn jeder Mensch sei, so Thomas, verpflichtet, für sein eigenes Leben mehr zu sorgen als für das eines anderen. Wird er also angegriffen, dann darf er auf Gewalt mit Gewalt reagieren, selbst wenn er den anderen dabei tötet. Entscheidend ist, dass er den Tod des anderen nicht beabsichtigt, sondern nur in Kauf nimmt.
Das klingt spitzfindig, spielt jedoch unter der Bezeichnung «Doppelwirkung» – eine Absicht, zwei Wirkungen – bei der Rechtfertigung moralischer Entscheidungen um Leben und Tod noch immer eine wichtige Rolle: Der Mediziner darf eine Sedierung mit der Absicht verabreichen, Schmerzen zu lindern. Wenn diese außerdem den Tod beschleunigt, dann wird dies moralisch nicht beanstandet, denn auch wenn diese zusätzliche Wirkung vorhersehbar ist, so liegt sie nicht in der Absicht. In der Schweizer Rechtsprechung wird es so ausgedrückt, dass der Tod nicht vorsätzlich herbeigeführt wird.
Die Lebensfremdheit der Kirche
Herr Kriesi, zwar war und ist die Wirkung der Tradition, die sich auf Augustinus und Thomas von Aquin beruft, noch immer mächtig, doch kaum ein Pfarrer in der Schweiz wird noch mit dem «ewigen Feuer» argumentieren.
Kaum ein Pfarrer innerhalb der Schweizer evangelischen Landeskirchen, ja. Aber innerhalb der evangelikalen Religionsgemeinschaften, da wirkt diese Tradition durchaus noch mit Macht. Wie oft passierte es mir während meiner Vorträge zur Freitodhilfe, dass da einer aufstand, die Bibel hochhielt und ins Publikum rief: «In meiner Bibel steht geschrieben: Meine Zeit steht in Gottes Händen!» Und selbst wenn vom «ewigen Feuer» in den Predigten der Landeskirche nicht länger die Rede ist: Unterschätzen Sie nicht, wie tief sich die kirchliche Verdammung des Suizids im Volksglauben eingenistet hat. Das haben wir ja etwa an Andelka gesehen. Tagtäglich habe ich es während meiner Arbeit als Pfarrer und später dann auch als Freitodbegleiter erlebt, wie sehr die Menschen weiterhin von diesen Vorstellungen umgetrieben werden. Egal welche Herkunft, egal welche Schulbildung. Egal ob Akademiker oder Handwerker. Viele leiden, weil in späteren Jahren der oft verschüttete Kindheitsglaube wieder hochkommt und damit die panische Angst, dass Gott sie verdamme. Erst gestern telefonierte ich mit einem Freund, fast so alt wie ich, er war bis zu seiner Emeritierung Professor für Psychiatrie. Er erzählte mir, wie tief beunruhigt und verängstigt er sei, wenn er an das Jüngste Gericht denke.
Mord und Genozid, Blutrache und Krieg, Todesstrafe und Menschenopfer. Gewaltsam gestorben wird in der Bibel reichlich. Mit wenigen Ausnahmen sind es keine Selbsttötungen. Das Alte Testament berichtet von König Saul, der sich ins Schwert stürzt, von Samson, der einen Tempel über sich zusammenbrechen lässt, oder von Abimelech, der einem seiner Soldaten befiehlt, ihn zu töten. Verurteilt wird dies nicht, auch nirgends verboten. Alle Selbsttötungen sind die Folge von Ehrverletzung oder Demütigung. Und nicht einer unheilbaren Krankheit oder eines unerträglichen körperlicher Leidens.
Diese spielten damals auch lange keine so große Rolle wie inzwischen in unseren Gesellschaften. In der Bibel waren in dieser Hinsicht die Verhältnisse kaum anders als noch bei uns vor zwei Generationen. Das durchschnittliche Alter, das man über Jahrtausende erreichte, betrug ungefähr 45 Lebensjahre. Seit dem letzten Jahrhundert steigt die Lebenserwartung. Noch Anfang der 1930er-Jahre erlebten 96 von 100 Menschen den siebzigsten Geburtstag nicht. Inzwischen werden wir durchschnittlich über achtzig Jahre alt. Dank dem Wohlstand, den geordneten politischen Verhältnissen und der hochentwickelten Medizin wird uns somit etwas geschenkt, was sich frühere Generationen nur erträumen konnten. Die paradoxe Kehrseite ist, dass dieses lange Leben zu ethisch-moralischen Problemen führt, von denen unsere Vorfahren keine Ahnung haben konnten. Die unerträgliche Situation, in die viele todkranke Menschen geraten sind, ist ja erst entstanden, weil die Medizin das Sterben immer weiter hinauszögern kann. Daher ist es so lebensfremd, so pathologisch auch, wenn die Kirche noch heute das Dogma von Thomas von Aquin vertritt, das er vor bald tausend Jahren, im Hochmittelalter, entwickelt hat. Die Lebenswelt damals hat doch nichts mit der heutigen Zeit zu tun! Wie kann man sich da noch auf den allmächtigen Gott, den Herrn berufen, der in seinem «unerforschlichen Willen» die Todesstunde eines Menschen bestimmt, um ihn zu sich in die «ewige Heimat» zu rufen?
Sie meinen, da wir den Tod mit unseren wissenschaftlichen Errungenschaften immer weiter hinauszögern können, haben wir auch die Verantwortung für den Verlauf unseres Lebens bis zum Ende mehr und mehr in die eigenen Hände genommen – die Kirche jedoch weigert sich weiterhin, uns auch für den Zeitpunkt des Todes ein Mitspracherecht zuzugestehen?
Wie oft höre ich von kirchlichen Kritikern: «Gott selbst hat uns das Leben geschenkt. Gott allein ist der Herr über Leben und Tod, und deswegen hat der Mensch kein Recht, selber über sein Ende zu entscheiden.» Diese theologisch-dogmatische Formel dient den Kirchen in allen Fragen der Sterbehilfe als Fundament und Richtschnur und zugleich als Begründung der Ablehnung. Von Bischofskonferenzen, Pfarrkonventen, Kirchenleitungen, in kirchlichen Publikationen jeglicher Couleur – und nicht zu vergessen, von der römischen Kurie – lesen und hören wir diese theologisch-stereotype Formel in endloser Wiederholung. Sie müssen dafür nur das soeben erschienene Schreiben der Glaubenskongregation des Vatikans lesen. Es trägt den Titel: «Schreiben über die Sorge an Personen in kritischen Phasen und in der Endphase des Lebens».24
In Ländern mit mehrheitlich katholischer Bevölkerung und einer gehorsamen Priesterschaft wird dieser Text eine enorme Wirkung entfalten. Aber nicht nur im Blick auf den assistierten Suizid, sondern auch auf andere Formen der Sterbehilfe. Ich denke an Heime und Kliniken, die von der katholischen Kirche geführt werden. Die autoritär verordnete Verweigerung der Sterbesakramente im Falle eines assistierten Suizids trifft nicht wenige katholisch erzogene Menschen mitten ins Herz. Das mag auch für solche gelten, die sich von der Kirche gelöst haben. Auch katholisch-gläubig gebliebene Angehörige werden sich mit Energie gegen einen assistierten Suizid zur Wehr setzen, wenn sie wissen, dass der Priester die Sterbesakramente nicht erteilen und der Gläubige die Krankensalbung nicht empfangen darf. Lesen Sie nur diesen Abschnitt hier aus dem vatikanischen Schreiben. Es geht um diejenigen, die ausdrücklich eine Sterbehilfeorganisation um assistierten Suizid gebeten haben. Diese sollen nur dann die Sakramente erhalten, wenn sie ihre Entscheidung ändern, somit zum «Büßer» werden, wie es heißt:
«In Bezug auf das Sakrament der Buße und Versöhnung muss der Beichtvater sich vergewissern, dass es Reue gibt, die für die Gültigkeit der Lossprechung notwendig ist, und die als ein ‹Schmerz der Seele und ein Abscheu über die begangene Sünde, mit dem Vorsatz, fernerhin nicht mehr zu sündigen› charakterisiert wird.»
Читать дальше