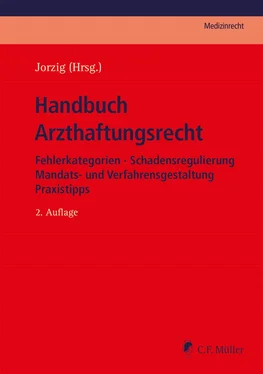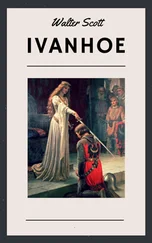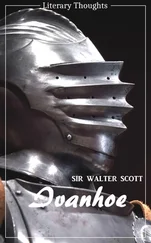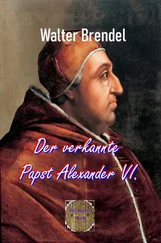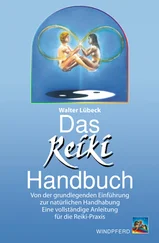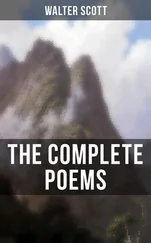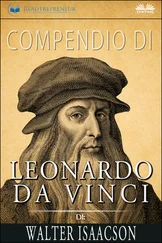A. Die Anspruchsgrundlagen 1 – 86 1. Hoheitliche oder privatrechtliche Tätigkeit des Arztes 1 Die Frage, ob ein Arzt hoheitlich oder privatrechtlich handelt, stellt sich grundsätzlich nur in Kliniken öffentlich-rechtlicher Träger und speziell, wenn es sich um beamtete Ärzte handelt. Bei der Krankenversorgung handelt es sich grundsätzlich nicht um eine hoheitliche Aufgabe[1]. Nach ständiger Spruchpraxis betätigt sich selbst der beamtete Chefarzt einer Klinik nicht hoheitlich, sondern fiskalisch[2]. 2 Eine besondere Stellung nahm nach der älteren Rechtsprechung der Durchgangsarzt ein. Traf der Durchgangsarzt die Entscheidung, welche Art der Heilbehandlung erforderlich war, handelte er hoheitlich. Behandelte er selbst weiter, tat er dies privatrechtlich. Diese Rechtsprechung hat der BGH nunmehr aufgegeben. Der Durchgangsarzt handelt immer hoheitlich. Es besteht ein enger und zeitlicher Zusammenhang mit der Entscheidung über das „ Ob “ und „ Wie “ der Heilbehandlung. Dieser einheitliche Lebensvorgang kann sinnvoll nicht in haftungsrechtlich unterschiedliche Tätigkeitsbereiche aufgespalten werden[3]. Das gilt auch für einen vom Durchgangsarzt hinzugezogenen weiteren Arzt[4]. Übernimmt allerdings der Durchgangsarzt nach Beendigung der stationären auch die ambulante Behandlung, so endet damit die hoheitliche Tätigkeit. Die ambulante Behandlung folgt den Regeln des Behandlungsvertrages[5]. Auch die neuere Rechtsprechung des BGH stellt auf eine Zäsur zwischen dem hoheitlichen und dem privatärztlichen Behandeln ab[6]. Die daraus resultierenden Abgrenzungsschwierigkeiten lassen an der Sinnhaftigkeit dieser Rechtsprechung zweifeln[7].
I. Übersicht 1 – 10 1. Hoheitliche oder privatrechtliche Tätigkeit des Arztes 1 Die Frage, ob ein Arzt hoheitlich oder privatrechtlich handelt, stellt sich grundsätzlich nur in Kliniken öffentlich-rechtlicher Träger und speziell, wenn es sich um beamtete Ärzte handelt. Bei der Krankenversorgung handelt es sich grundsätzlich nicht um eine hoheitliche Aufgabe[1]. Nach ständiger Spruchpraxis betätigt sich selbst der beamtete Chefarzt einer Klinik nicht hoheitlich, sondern fiskalisch[2]. 2 Eine besondere Stellung nahm nach der älteren Rechtsprechung der Durchgangsarzt ein. Traf der Durchgangsarzt die Entscheidung, welche Art der Heilbehandlung erforderlich war, handelte er hoheitlich. Behandelte er selbst weiter, tat er dies privatrechtlich. Diese Rechtsprechung hat der BGH nunmehr aufgegeben. Der Durchgangsarzt handelt immer hoheitlich. Es besteht ein enger und zeitlicher Zusammenhang mit der Entscheidung über das „ Ob “ und „ Wie “ der Heilbehandlung. Dieser einheitliche Lebensvorgang kann sinnvoll nicht in haftungsrechtlich unterschiedliche Tätigkeitsbereiche aufgespalten werden[3]. Das gilt auch für einen vom Durchgangsarzt hinzugezogenen weiteren Arzt[4]. Übernimmt allerdings der Durchgangsarzt nach Beendigung der stationären auch die ambulante Behandlung, so endet damit die hoheitliche Tätigkeit. Die ambulante Behandlung folgt den Regeln des Behandlungsvertrages[5]. Auch die neuere Rechtsprechung des BGH stellt auf eine Zäsur zwischen dem hoheitlichen und dem privatärztlichen Behandeln ab[6]. Die daraus resultierenden Abgrenzungsschwierigkeiten lassen an der Sinnhaftigkeit dieser Rechtsprechung zweifeln[7].
1. Hoheitliche oder privatrechtliche Tätigkeit des Arztes 1, 2
2. Das dualistische Anspruchssystem 3 – 9
3. Behandlungsfehlervorwurf 10
II. Vertragliche Haftung 11 – 28
1. Der Behandlungsvertrag 11 – 18
2. Vertragspartner 19, 20
3. Vertragspflichten 21
4. Behandlung 22
5. Standard 23
6. Abweichende Vereinbarungen 24
7. Anwendbare Vorschriften 25 – 28
a) § 630b 25, 26
b) Haftung 27, 28
III. Deliktische Haftung 29 – 38
IV. Vergleich der vertraglichen und deliktischen Haftpflicht 39 – 53
1. Sorgfaltspflichten und Fehlverhalten des Arztes 41 – 43
2. Einstehenmüssen für das Fehlverhalten von Hilfspersonen 44
3. Haftungsbeschränkungen 45 – 49
4. Expertenstatus des Arztes und Selbstbestimmungsrecht des Patienten 50
5. Beweislast für anspruchsbegründende Voraussetzungen 51
6. Prägnante Unterschiede 52, 53
V. Klagebefugnis, Aktiv- und Passivlegitimation 54 – 62
1. Klagebefugnis 55, 56
2. Aktivlegitimation 57 – 60
3. Passivlegitimation 61, 62
VI. Fehler eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 63 – 70
VII. Krankenhausträger 71, 72
VIII. Selbstliquidierende Ärzte und Belegärzte 73 – 76
IX. Instituts- und Chefarztambulanzen 77 – 80
X. Beamtete Ärzte 81 – 84
XI. Notarzt 85
XII. Hebammen 86
B. Inhalt, Art und Umfang – die Rechtsfolgenseite 87 – 106
I. Überblick 87 – 90
II. Schadensarten 91 – 104
1. Unmittelbare, mittelbare und Folgeschäden bei Dritten 92 – 94
2. Materielle und immaterielle Schäden 95 – 104
a) Materielle Schäden 96 – 99
b) Immaterieller Schaden 100 – 104
III. Mitverschulden 105, 106
C. Sonstige Anspruchsgrundlagen im Überblick 107 – 133
I. Allgemeines 107, 108
II. Haftung nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) 109 – 118
III. Haftung für Medizinprodukte 119 – 127
IV. Haftung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) 128 – 133
A. Die Anspruchsgrundlagen
I. Übersicht
1. Hoheitliche oder privatrechtliche Tätigkeit des Arztes
1
Die Frage, ob ein Arzt hoheitlich oder privatrechtlich handelt, stellt sich grundsätzlich nur in Kliniken öffentlich-rechtlicher Träger und speziell, wenn es sich um beamtete Ärzte handelt. Bei der Krankenversorgung handelt es sich grundsätzlich nicht um eine hoheitliche Aufgabe[1]. Nach ständiger Spruchpraxis betätigt sich selbst der beamtete Chefarzt einer Klinik nicht hoheitlich, sondern fiskalisch[2].
2
Eine besondere Stellung nahm nach der älteren Rechtsprechung der Durchgangsarzt ein. Traf der Durchgangsarzt die Entscheidung, welche Art der Heilbehandlung erforderlich war, handelte er hoheitlich. Behandelte er selbst weiter, tat er dies privatrechtlich. Diese Rechtsprechung hat der BGH nunmehr aufgegeben. Der Durchgangsarzt handelt immer hoheitlich. Es besteht ein enger und zeitlicher Zusammenhang mit der Entscheidung über das „ Ob “ und „ Wie “ der Heilbehandlung. Dieser einheitliche Lebensvorgang kann sinnvoll nicht in haftungsrechtlich unterschiedliche Tätigkeitsbereiche aufgespalten werden[3]. Das gilt auch für einen vom Durchgangsarzt hinzugezogenen weiteren Arzt[4]. Übernimmt allerdings der Durchgangsarzt nach Beendigung der stationären auch die ambulante Behandlung, so endet damit die hoheitliche Tätigkeit. Die ambulante Behandlung folgt den Regeln des Behandlungsvertrages[5]. Auch die neuere Rechtsprechung des BGH stellt auf eine Zäsur zwischen dem hoheitlichen und dem privatärztlichen Behandeln ab[6]. Die daraus resultierenden Abgrenzungsschwierigkeiten lassen an der Sinnhaftigkeit dieser Rechtsprechung zweifeln[7].
2. Das dualistische Anspruchssystem
3
Jeder arzthaftungsrechtliche Anspruch kann sich sowohl aus Vertrag als auch aus Delikt ergeben. Die Verletzung einer vertraglichen Pflicht aus dem Behandlungsvertrag wird in der Regel zugleich zu einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, des Lebens, oder auch des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Patienten nach § 823 Abs. 1 BGB führen. Es kommt mithin bei einem Fehlverhalten eines Arztes sowohl eine vertragliche als auch eine deliktische Haftpflicht in Betracht. Haftungsansprüche des Patienten gegen den Behandelnden können auf die eine wie die andere Anspruchsgrundlage gestützt werden; sie bestehen nebeneinander (Anspruchskonkurrenz).[8] Die Schadensersatzsumme verdoppelt sich dadurch freilich nicht.
Читать дальше