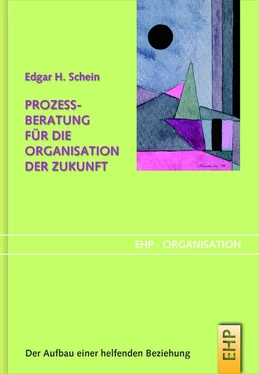Aus diesem Grund wird in der Beratungsliteratur so großes Gewicht auf den »Vertrag« am Anfang der Beziehung gelegt. Doch in den frühen Stadien ihrer Beziehung reichen weder die Informationen des Helfers noch die des Klienten aus, um einen hieb- und stichfesten Vertrag ausarbeiten zu können. Vielleicht wäre es daher ein besseres Konzept, sich über »wechselseitige Erwartungen« zu einigen als über einen »Vertrag«. Der Helfer sollte sicherlich über die impliziten Erwartungen des Klienten Bescheid wissen, allerdings können einige dieser impliziten Erwartungen unbewusst sein und erst zum Vorschein kommen, wenn sie verletzt werden. Zum Beispiel gehen Klienten insgeheim oft davon aus, dass die Geschichte, die sie erzählen, zweifelsohne akzeptiert wird. Will der Berater dann wissen, warum der Klient dieses oder jenes getan hat oder zu tun gedenkt, ist er vielleicht schockiert und entsetzt. Erst dann wird den beiden beteiligten Parteien klar, dass stillschweigend von einer Billigung ausgegangen worden und diese auch gewünscht war.
Auf der Seite des Beraters kann es die implizite Erwartung geben, dass seine Vorschläge angehört werden und eine faire Chance bekommen. Er wird seinerseits geschockt und entsetzt sein, wenn der Klient sich gegen ihn wendet und seinen Vorschlag als trivial oder offensichtlich nicht umsetzbar abtut. Beim Aufbau einer helfenden Beziehung ist es wichtig, dass man versucht, aus solchen Gefühlen zu lernen und sie nicht als Anlass nimmt, voneinander enttäuscht zu sein. Sie müssen als normaler Prozess beim Aufbau einer Beziehung betrachtet werden, als ein Zugang zu neuen Erkenntnissen und Lernprozessen.
Diese sozialen Kräfte werden weiter kompliziert durch die Psychodynamik der Übertragung und Gegenübertragung, die vom Berater verlangt, sein Augenmerk auf die Projektionen des Klienten zu richten – darauf, was der Klient auf ihn projiziert, und darauf, was er selbst auf die Wirklichkeit des Klienten projiziert bzw. wie sehr er dazu tendiert, diese Wirklichkeit falsch zu verstehen. Für den Berater bedeutet die Wahrnehmung der Realität und der Umgang mit ihr vor allem zu lernen, seine eigenen inneren Verzerrungen wahrzunehmen und damit umzugehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Berater lernen, ihr Nichtwissen einzusetzen und ihre Stereotype zu überwinden.
Die Beziehung wird erst dann fruchtbar, wenn beide Parteien sich mit ihrem eigenen Status und ihrer eigenen Rolle sowie denen des Gegenübers wohl zu fühlen beginnen. Dabei beeinflussen kulturelle Normen unsere Anschauung darüber enorm, welche Form der Abhängigkeit wir legitimer finden. Man ist eher bereit, sich in eine Abhängigkeit zu begeben, wenn man einen hochangesehenen Therapeuten, Psychiater, Coach oder Berater aufsucht, als wenn man sein Problem einem Freund oder Bekannten anvertraut. Wer sich mit einem beruflichen Problem an seinen Chef wendet, wird sich weniger vorsehen, sich abhängig zu machen, als wer damit zu einem gleichrangigen Kollegen oder einem Untergebenen geht.
In jeder Gesellschaft gibt es Normen darüber, welche Formen der Abhängigkeit als legitim betrachtet werden und welche einen Gesichtsverlust zur Folge haben. In der westlichen, wettbewerbsorientierten, individualistisch geprägten Gesellschaft gilt so gut wie jede Abhängigkeit als Gesichtsverlust, während in vielen asiatischen Gesellschaften die Abhängigkeit von Älteren oder Höhergestellten geradezu erwartet wird. Je egalitärer eine Gesellschaft ist, desto schwieriger ist es, sich darüber klar zu werden, welche Gefühle gegenseitige Abhängigkeiten auslösen. Daher ist wohl die Klärung solcher Gefühle in der westlichen Gesellschaft schwieriger als in vielen anderen Kulturen.
Beziehungsaufbau auf verschiedenen Stufen gegenseitiger Akzeptanz
Bei der ersten Begegnung zwischen dem Hilfesuchenden und dem Helfer treten sämtliche oben beschriebenen Faktoren in Aktion. Wie entwickelt sich dann aus dem ersten Gespräch allmählich eine Beziehung, in der die beiden Parteien einander zuhören, verstehen und ihre wechselseitigen Bedürfnisse erfüllen? Das beste Modell, um diesen Prozess zu beschreiben, ist, das Ganze als eine Reihe gegenseitiger Tests zur Überprüfung zu sehen, auf welcher Stufe die Parteien einander jeweils akzeptieren können. Während der Klient seine Geschichte darstellt, wird er sehr genau darauf achten, inwieweit der Berater aktiv zuhört, das Gesagte versteht und ihn unterstützt. Erscheint ihm die Unterstützung sicher und hat er das Gefühl, was immer er sagt, wird – wenn auch nicht alles vollkommen gutgeheißen – so doch zumindest verstanden, wird er sich auf eine privatere, intimere Stufe vorwagen, bis er fürchtet, er könnte zuviel von sich preisgeben und damit den Helfer oder vielleicht sogar sich selbst überfordern. Der Berater muss sich darüber im Klaren sein, dass kulturelle Normen stets begrenzen, wie »offen« ein Gespräch werden kann. So etwas wie »alles raus lassen« gibt es nicht. Es wird immer Bewusstseinsebenen geben, die der Klient für sich behalten und nicht einmal einem Berater, dem er vertraut, enthüllen will. Und es gibt Bewusstseinsschichten, die wir nicht einmal selbst akzeptieren können und deshalb verdrängen.
Auf der anderen Seite wird der Helfer genau austarieren, wie der Klient auf seine Anregungen, Fragen, Vorschläge und auf sein ganzes Auftreten als Berater reagiert. Er will herausfinden, wie groß die Abhängigkeit ist, auf die der Klient sich einzulassen bereit ist, und wie bereit er (der Berater) selbst ist, sich auf diese Abhängigkeit einzulassen. Je mehr der Klient den Berater akzeptiert, desto bereiter wird dieser (der Berater) ihn in seine verborgeneren Gedankengänge einweihen und eine tiefere Gesprächsebene zulassen. Aber während dieses gesamten Prozesses überprüfen sich die beiden Parteien ständig gegenseitig und achten auf gefährliches Feedback. Tritt dieses dann auf, müssen beide Parteien ihre Beziehung erneut auskalibrieren und den psychologischen Vertrag überdenken: Hat eine der beiden Parteien eine implizite Grenze übertreten? Lässt sich der implizite Vertrag neu verhandeln oder hat die Beziehung eine Ebene erreicht, über die sie nicht hinauskommt? Oder, schlimmer noch, wurde sie in einem Ausmaß beschädigt, dass entweder Klient oder Berater das Gefühl haben, sie beenden zu müssen? Wir alle haben diese Erfahrung bereits gemacht, Vertrauen aufzubauen kostet weitaus mehr Kraft und Zeit, als es zu verlieren. Entscheidend bei dem Aufbau gegenseitigen Vertrauens ist daher, dabei langsam vorzugehen, das Ziel – zunehmende gegenseitige Akzeptanz und gleich hoher Status in der Beziehung – nicht aus den Augen zu verlieren. Die kritischen Interventionen bestehen darin, den Klienten seine Geschichte erzählen zu lassen und engagiert nachzufragen, d.h. der Helfer arbeitet mit seinem Nichtwissen und behebt seine Wissenslücken.
Dieser Prozess, das gilt es zu beachten, kann durchaus als wechselseitiger Prozess des Helfens betrachtet werden. Der Helfer kann Vertrauen herstellen, indem er tatsächlich auf jeder Ebene akzeptiert, was der Klient von sich preisgibt, und dabei vielleicht auch seine eigenen Vorstellungen über das Geschehen ändert. In einem gewissen Sinn ist der Helfer vom Klienten abhängig, um exakte Informationen zu erhalten und die benötigte emotionale Rückmeldung. Und der Helfer muss bereit sein zu helfen, damit der Klient das notwendige Vertrauen aufbauen kann, ohne das er seine tieferen Gefühle nicht zeigen wird. Je mehr die beiden Parteien sich gegenseitig helfen und helfen lassen, desto ausgeglichener wird die Beziehung.
Implikationen für die Praxis
Um ein Klima für eine effektive Beratungssituation zu schaffen, muss sich der Helfer zunächst die bislang dargestellten fünf übergreifenden Prinzipien vergegenwärtigen (»Versuche stets zu helfen«; »Verliere nie den Bezug zu der aktuellen Realität«; »Setze dein Nichtwissen ein«; »Alles, was du tust, ist eine Intervention«; »Das Problem und seine Lösung gehören dem Klienten«). Dem können wir nun ein sechstes Prinzip hinzufügen, dass es stets zu beachten gilt.
Читать дальше