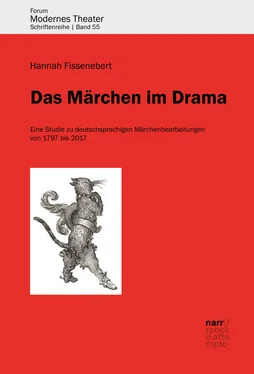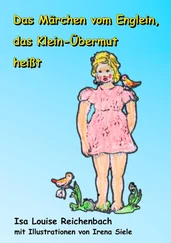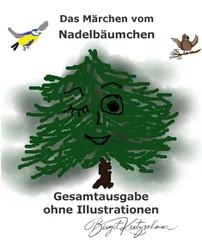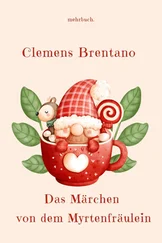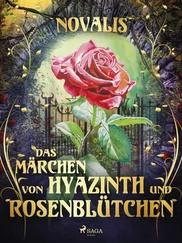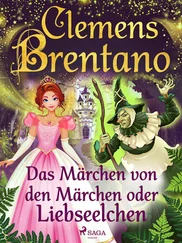PERNULLO
Ich könnte die beiden Prinzen an die Enden meines Narrenseils binden und mein Brot dabei verdienen. Der eine liebt eine hundertjährige Schönheit, der andere betet vollends einen Pantoffel an. Was soll aus unserm Hofe werden? Der eine wird die Toupets wieder einführen wollen, weil seine Geliebte weiland eins getragen; der andere wird uns zwingen, in gläsernen Stiefeln zu gehen, bis wir uns die Scherben in die Füße treten.8
Platen schafft insofern eine Komödie im Sinne von Lisa Hutcheons „paradox of parody“9, als dass er eine theatral-affirmative Vergrößerung der wundersamen Handlung beider Märchen und zugleich eine humorvolle Distanzierung von der naiv-romantischen Art ihres Personals vornimmt. So wird die Märchenvorlage durch die teils ironische Behandlung in eine tendenziell selbstreflektierende und distanzierte Zuspitzung getrieben. Große Befriedigung zieht Pernullo gerade aus dem gewitzten Schlagabtausch über das Theaterspiel mit dem intellektuell gleichgesinnten Schauspieler Hegesippus.10 Die selbstreferentiellen Elemente dieses Dialogs, die an Tiecks Thematisierung des Schauspiels in seinem Gestiefelten Kater erinnern, kreieren beim Rezipienten eine weitere ironische Distanz zum Geschehen. So konstruiert Platen eine Adaptation, die latent Ironie in sich trägt und durch ihre heiteren Satireelemente vermeidet, zu einem unreflektierten Märchenstück zu werden.
Durch diese Transformation, die sich in kontrastierender und zugleich verspielter Übertreibung äußert, wird nicht zuletzt die theatrale Verwandtschaft des Dramas und des Märchens offengelegt und betont. Dies geschieht vor allem dank des Narren Pernullo, der fröhlich Spott mit der ausgestellten Verklärtheit der märchenhaften Figuren treibt. Ähnlich wie die Masken in den Fiabe , die Platen sehr schätzt, lässt er Pernullo die Märchengeschehnisse immer wieder ironisch kommentieren.11
Nichtsdestotrotz bleibt die Distanz zum aristokratischen Märchenpersonal bei Platen, der selbst einer Adelsfamilie entstammt, dem Bereich des Närrischen verhaftet.12 Denn auch wenn Pernullo hin und wieder die wunderlichen Geschehnisse am Hof satirisch kommentiert, liegt der dramaturgische Fokus auf Aschenbrödels Hochzeit mit dem Prinzen.13 Indem allein Aschenbrödel, die klügste und anständigste Tochter eines Edelmanns, die königliche Braut werden kann, wird innerhalb des Stückes tendenziell eher der Erhalt einer sozialen und politischen Hegemonie der Aristokratie gefestigt. So bedient Platens Adaptation gängige ästhetische Selbstdarstellungen und -stilisierungen der Adelsklasse.14 Grundsätzlich wird so die gesellschaftliche Vormachtstellung des Adels durch Aschenbrödels Hochzeit mit dem Prinzen bestätigt und im glücklichen Ausgang des Stückes unhinterfragt propagiert. Allein wenn rangniedere Figuren wie Pernullo die Bestrebungen der Prinzen als närrisch und verklärt entlarven, schwingt eine leicht humorvoll formulierte Skepsis über einen weltfremd agierenden Adel mit.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Platen den Ansatz Tiecks, eine selbstironische Märchenadaptation zu erschaffen, in Teilen übernimmt und durch eine Figurenkonstellation umrahmt, die auf Gozzis kontrastreiche Dramaturgie zurückgreift. Platen wählt das Märchen, um sich der genreüblichen Stereotype seiner Figuren, der weltfremden Motive seiner Protagonisten und der fantastischen Motive seiner Handlung zu bedienen. Insgesamt zeigt sich Platens Märchenkomödie nur subtil ironisch. Mit dem Gläsernen Pantoffel strebt Platen so größtmöglichen Unterhaltungswert an und lässt von einem ernsthaften satirischen Zugriff ab.
Christian Dietrich Grabbe Aschenbrödel: Dramatisches Märchen (1829/35)
In seiner satirischen Dimension sehr viel eindeutiger zeigt sich wenig später Grabbes Bearbeitung von Cendrillon ou la petite pantoufle de vair .1 Das Motiv des Aschenbrödels , das damals immer wieder in Unterhaltungsstücken und Opern aufgegriffen wird, enthält bei Grabbe mannigfaltige Kritik an einer Gesellschaft, die in der Darstellung des Autors von Habgier und Materialismus geprägt ist.2 Bereits Perraults Vorlage und andere verwandte Bearbeitungen weisen das Motiv des gesellschaftlichen Strebens nach einer lukrativen Heirat auf, das von Grabbe mit zynischem Humor verstärkt wird: „Wie ein Perrault-Märchen zum Ausgangspunkt eines szenischen Spiels gemacht werden kann, in dem neben der Welt des Wunderbaren auch satirisch gespiegelte Realitätsfragmente Platz haben können, das hatte Tieck vorgemacht […]. Hier konnte Grabbe anknüpfen.“3
Im Vordergrund der Handlung steht ein Baron mit seiner neuen Frau und deren zwei Töchtern, die sein Geld verprassen, sodass er erhebliche Schulden bei dem Bankier Isaak aufnehmen muss. Des Barons Tochter aus erster Ehe, Olympia, muss ihnen in Aschenbrödel-Manier dienen. Schließlich gibt der König einen Ball, auf dem der Rüpel in königlicher Kleidung auftritt, sodass sich der König inkognito nach einer nicht opportunen Frau umschauen kann. Dort verliebt er sich in Olympia, die sich gleichfalls unerkannt unter die Feiernden gemischt hat.
Inhaltlich interessiert Grabbe dabei vor allem das Thema der Wahrheitssuche. So liegt der Fokus darauf, dass Olympia sich ihr Glück mit dem König verdient, indem sie hinter die Fassade schaut und dem wahren König trotz seiner Verkleidung ihre Zuneigung schenkt. Vorbereitet wird diese Perspektive unter anderem durch einen Dialog zwischen dem König und seinem Berater Mahan, aus dem hervorgeht, dass im Umfeld des Königs Oberflächlichkeit und Heuchelei vorherrschen:
KÖNIG Der Narr und Krüppel soll den König spielen.
MAHAN Erlaubst Du es, wird es Dich gar ergötzen.
Seh’n wirst Du wie er auch als König Narr bleibt.
Und doch für weise gilt. Verschwinden wird der
Hocker, der ihm drückt den Rücken,
Dazu für modisch noch erklärt. Verachtet wirst du
an seiner Seite stehen, – wenn
Du redest, kaum ein mitleidsvoller Blick
Dich treffen.4
Auf dem Ball unterhalten sich der Rüpel als vermeintlicher König und der verkleidete König mit Olympia sowie ihren Stiefschwestern Louison und Clorinde über ein Schauspiel, das gerade gegeben wurde. Dieses wird von den Stiefschwestern mit schmeichelhaften Beschreibungen gelobt. Nur Olympia sagt frei heraus, dass ihr das Stück nicht gefallen habe und begeistert mit ihrer Ehrlichkeit den König, der ebenfalls keine hohe Meinung von dem Schauspiel hat.5 Weitere Unterstützung findet die aufrechte Olympia bei ihrer Patin, der Feenkönigin, die jener mit ihrem Gefolge aus Feen, Gnomen und den von ihr verwandelten Tieren erst einen märchenhaften Auftritt auf dem Ball und schließlich die Ehe mit dem König beschert. Komisch-absurde Szenen entstehen vor allem durch die von der Feenkönigin verwandelten Tiere; so behält etwa eine zu Olympias Kutscher mutierte Ratte ihr tierisches Wesen bei.
Ebenso wie bei Grabbes Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung (1822-27) handelt es sich bei seinem Aschenbrödel um ein von Tieck beeinflusstes satirisches Lustspiel, das sich ebenfalls kritisch mit zeitgenössischer Literatur auseinandersetzt. Im Hinblick auf eine satirische Betrachtung der Literaturszene ist Grabbes erste Fassung des Märchendramas von 1829 allerdings sehr viel reichhaltiger, da er sich hier noch mit ironischen Kommentaren explizit über die stilistischen Eigenarten seiner literarischen Zeitgenossen lustig macht (unter anderen über Karl Immermann und August von Platen).
Indem Grabbe die desillusionierenden und romantisch geprägten Satiremomente in seiner finalen Fassung zugunsten einer unironischen Märchenerzählung tilgt, wird auch die ursprüngliche Intention, ein satirisches Lustspiel zu verfassen, verdeckt.6 Erhalten blieben nur einige wenige Passagen, in denen sich Grabbe über die deutschsprachige Literatur echauffiert. So unterhält sich der Baron etwa mit dem Kutscher (der verwandelten Ratte) und zwei Herren auf dem Ball des Königs:
Читать дальше