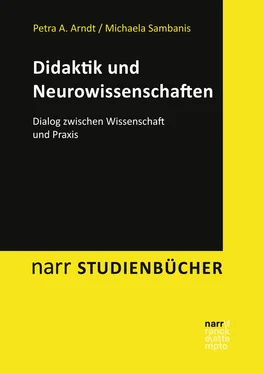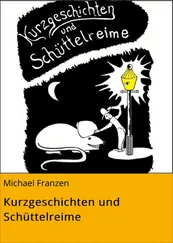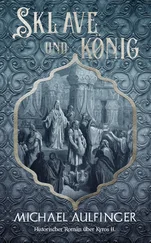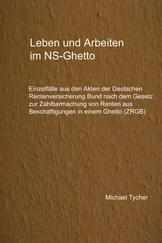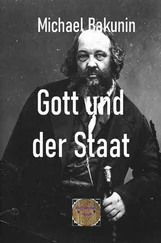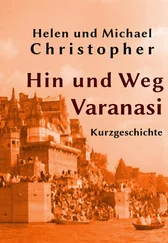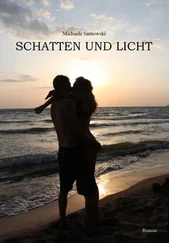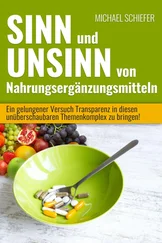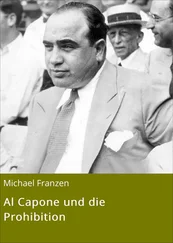Wie später noch ausgeführt wird (vgl. Infobox Kap. 3), können viele der im PraxisfensterPraxisfenster vorgeschlagenen Unterrichtsimpulse in Aktionsforschungsprojekten (vgl. Altrichter et al. 2006) von Praktikerinnen und Praktikern sowie Studierenden, wenn diese z.B. im Rahmen des Praxissemesters ein Lernforschungsprojekt durchzuführen haben, hinsichtlich ihrer Eignung, Akzeptanz durch die Lerngruppe und der intendierten Effekte im Praxisfeld beleuchtet werden. Dadurch können zu einzelnen praxisrelevanten Fragestellungen im Unterricht mit oftmals überschaubarem Aufwand Erkenntnisse generiert werden, die, in ihrer eigenen Art und Weise und mit dem jeweils angemessenen Geltungsbereich, als komplementär zu den Erkenntnissen der Neurowissenschaften betrachtet werden können. 6
Der vorliegende Band verfolgt nicht das Ziel, eine bestimmte Unterrichtsmethode zu legitimieren oder zu propagieren. Vielmehr begeben sich die Autorinnen unvoreingenommen auf Spurensuche nach Wissensbeständen, die für das Lehren und Lernen, insbesondere in institutionalisierten Kontexten, bedeutsam erscheinen. Dabei werden Schwerpunkte gesetzt, die einerseits grundlegende Aspekte des Themas Lehren und Lernen fokussieren, andererseits werden aber auch Schlaglichter gesetzt auf Einzelfragen, die das pädagogische Handeln und ein planvolles Innovieren von Unterricht betreffen. Einige Informationen werden, vom sonstigen Text graphisch abgesetzt, in InfoboxenInfobox bereitgestellt. Sie enthalten vertiefende bzw. ergänzende Informationen oder erläutern Hintergründe.
Als Autorinnen haben sich zwei Wissenschaftlerinnen zusammengetan, die im Bereich der interdisziplinäreninterdisziplinär und auf TransferTransfer ausgerichteten Forschung bereits seit Jahren tätig sind. Gemeinsam decken sie mit ihrer Expertise das Spektrum dessen, was für eine sich aus kritischer RezeptionRezeption speisende Verbindung von Neurowissenschaften und Didaktik samt Verankerung eines wechselseitigen Dialogs unverzichtbar erscheint, wie folgt ab: Neurobiologie, Psychologie, Erziehungswissenschaft, Fremdsprachendidaktik sowie langjährige Tätigkeit als Lehrkraft, in der Lehrkräfteausbildung sowie im Coaching und der wissenschaftlichen Begleitung von Bildungseinrichtungen.
Didaktik und Neurowissenschaften lädt zu einer Spurensuche ein, die von Interesse und NeugierNeugier getragen ist, sich um eine kritische Auseinandersetzung mit Wissensbeständen sowie um ein Zusammenführen von Erkenntnissen bemüht und die sich bei der Frage nach Konsequenzen für die Praxis und beim Abgleich mit Praxiserfahrungen statt der Rezeptorientierung dem divergenten Denken verpflichtet fühlt.
Ausgewählte Literaturhinweise
Blakemore, S.-J. & Frith, U. (2006): Wie wir lernen. Was die Hirnforschung darüber weiß. München: Deutsche Verlags-Anstalt.
Müller, T. (2005): Pädagogische Implikationen der Hirnforschung. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse und ihre Diskussion in der Erziehungswissenschaft. Berlin: Logos.
2. Gehirn und Hirnentwicklung
In diesem Kapitel werden die grundlegenden Prinzipien des Gehirns vorgestellt. Allerdings reicht es für unsere Zwecke nicht aus, das „fertige“ Gehirn von Erwachsenen zu betrachten, allein schon deshalb, weil sich sehr viele Lehr-Lernarrangements und didaktische Vorgehensweisen an junge, sich entwickelnde Menschen richten. Hinzu kommt, dass sich viele LernprozesseLernprozesse besser verstehen und einordnen lassen, wenn man die Entwicklung des Gehirns berücksichtigt. Jeder neue Lerninhalt bringt eine (mehr oder weniger große) Umstrukturierung des Gehirns mit sich. Die dabei wirkenden Mechanismen werden durch die Betrachtung der Hirnentwicklung sehr deutlich. Der Schwerpunkt der Darstellungen liegt daher auf der Beschreibung der Entwicklung des Gehirns.
Sowohl das Gehirn an sich als auch sein Entwicklungsprozess ist ein faszinierendes Wunder der Natur. Mitunter wird kritisiert, Wissenschaft „entzaubere“ die Welt, beraube sie ihrer „Magie“ und reduziere das Wunder des Lebens auf physikalische, chemische und biologische Zusammenhänge. Für das Gehirn und seine Entwicklung besteht das Risiko einer solchen Entzauberung nicht. Vielmehr ist das Gehirn eine Welt, die mindestens ebenso wundersam ist wie das Wunderland, in dem Alice ihre Abenteuer erlebte (vgl. Carroll 1999).
2.1 Ein Gehirn entsteht: Von einer dünnen Zellschicht zur komplexen Struktur
Das menschliche Gehirn enthält ein kompliziertes Geflecht aus etwa 86 Milliarden NervenzellenNervenzellen (vgl. Azevedo et al. 2009).1 Diese Zahl ist so groß, dass man sie sich schlicht nicht vorstellen kann. Würde man für jede Nervenzelle eine 1-Euro-Münze nehmen und die Münzen wie Perlen auf eine Kette auffädeln, dann wäre die Kette so lang, dass sie fünf Mal um die Erde herumreichte.2
Eine andere Möglichkeit, ein Gefühl für die enorme Anzahl an NervenzellenNervenzellen zu entwickeln, ist es, sich zu verdeutlichen, dass während der Schwangerschaft ab der 4. Woche (das ist der Zeitpunkt, ab dem Gehirn und RückenmarkRückenmark angelegt sind) bis zur Geburt pro Minute etwa 250.000 Nervenzellen gebildet werden. Umgerechnet bedeutet das: In jeder einzelnen Sekunde entstehen durchschnittlich etwas über 4000 neue Nervenzellen. Linderkamp, Janus et al. (2009) fassen diesen Vorgang so zusammen:
Das fetale Gehirn entwickelt sich in wenigen Wochen aus einer dünnen Zellschicht zu einem gigantischen und komplexen NetzwerkNetzwerk mit Milliarden von NervenzellenNervenzellen (NeuronenNeuronen) und Billionen von Verbindungen (SynapsenSynapse).
Während dieser Zeit entstehen:
das RückenmarkRückenmark voller Neurone, die Signale an die Muskulatur leiten und solchen, die Informationen von den Tastsinneszellen auf unserer Körperoberfläche aber auch aus unserm Körperinneren weiterleiten,
der HirnstammHirnstamm, der RückenmarkRückenmark und Groß- und KleinhirnKleinhirn verbindet und lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Herzschlag und Reflexe wie den Hustenreflex steuert,
das Zwischenhirn, das mit dem Thalamus Thalamus eine wichtige Umschaltstation für Informationen von den Sinnesorganen beheimatet und mit dem Hypothalamus Hypothalamus und der Hypophyse Hypophyse das Bindeglied zwischen Nervensystem und Hormonhaushalt bildet,
das KleinhirnKleinhirn, dessen dichtgepackte Neurone Bewegungskoordination und Gleichgewicht steuern,
und das Großhirn, das wir in seiner Entwicklung im Folgenden genauer betrachten wollen.
Die vielen Neurone, die später unsere GroßhirnrindeGroßhirnrinde (den CortexCortex) bilden, unsere berühmten „grauen Zellen“, werden von StammzellenStammzellen gebildet, die in einem sehr dünnen Häutchen auf der Innenseite einer bläschenartigen Struktur liegen, aus der sich später einmal das Gehirn entwickelt. Die Stammzellen teilen sich unablässig und bilden Zellen, aus denen sich NervenzellenNervenzellen entwickeln, aber auch weitere Stammzellen. Die neu entstandenen, noch unreifen Nervenzellen, die sogenannten NeuroblastenNeuroblasten, können nicht in dem dünnen Häutchen bleiben, in dem sie „geboren“ wurden. Der Platz ist von den Stammzellen bereits belegt. Also begeben sich die Neuroblasten auf Wanderschaft, um zu der Stelle der Hirnrinde zu gelangen, an der sie später als Neurone ihre Arbeit verrichten sollen. Wie bei den großen Wanderbewegungen der Menschheit auch, nennt man diesen Vorgang MigrationMigration. Allerdings finden die jungen Neuroblasten ihren Weg nicht alleine. Vielmehr erhalten sie bei ihrer Wanderschaft zum ersten Mal in ihrem Leben Unterstützung durch sogenannte Gliazellen. Eigentlich ist der Begriff Gliazellen recht unspezifisch: Man fasst darunter all jene Zellen des Gehirns zusammen, die eben nicht Nervenzellen sind. Gliazellen sind wichtige Helfer und Unterstützer der Nervenzellen. Sie haben sehr unterschiedliche Formen und vielfältige Aufgaben. Im menschlichen Gehirn gibt es etwa ebenso viele Gliazellen wie Nervenzellen (vgl. Azevedo et al. 2009). Sie versorgen die Nervenzellen mit Nährstoffen, halten die Umgebung sauber und frei von Krankheitserregern, dienen als Schutz und Stützgewebe, unterstützen die Kommunikation der Nervenzellen untereinander usw.
Читать дальше