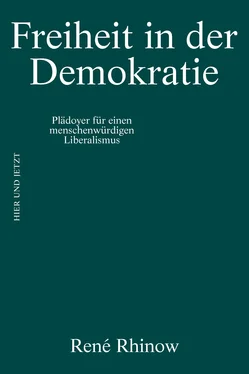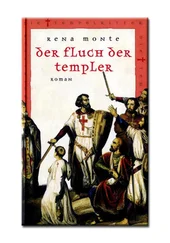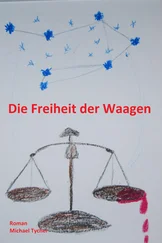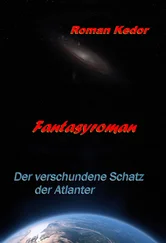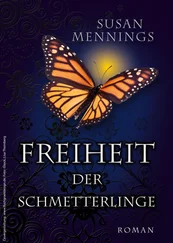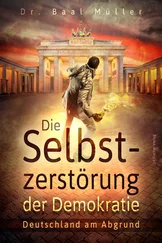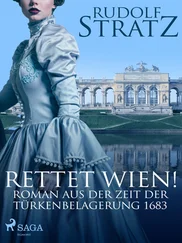Krisenerscheinungen in der Demokratie
Im dritten Teil «Von den Säulen der Demokratie» geht es um den Versuch, angesichts einer weltweit diagnostizierten Demokratiemüdigkeit, ja einer Krise der liberalen Demokratie bis hin zu deren Verfremdung zu einer «illiberalen Demokratie», 27Grundelemente der Demokratie in den Fokus zu rücken. Die Globalisierung hat in westlichen Gesellschaften ein Gefühl der Machtlosigkeit hervorgerufen, das zu Ressentiments und Schuldzuweisungen führt. Die Schuld an dieser Entwicklung wird wahlweise den Immigrierten, den Musliminnen und Muslimen, anderen Ethnien oder den kulturellen Eliten zugewiesen. Negative Auswirkungen der Globalisierung werden als essenzielle Bedrohung wahrgenommen. Dazu zählen neben der Migration auch die Suche nach einer verlorenen Identität sowie das Spannungsverhältnis zwischen einem Verlust an nationalstaatlicher Souveränität und einer parallel dazu schwindenden nationalstaatlichen Problemlösungsfähigkeit. Darauf gehe ich in meiner Studie über den Nationalstaat im vierten Teil dieses Bands näher ein.
Carlo Strenger verdanken wir eine schonungslose Analyse der liberalen Demokratie und deren Krise. Er geht vom dominanten Konflikt zwischen Liberalismus und Autoritarismus und damit zusammenhängend zwischen Universalismus und Nationalismus aus. 28Ängste 29und Verunsicherungen aufgrund von Globalisierung, Zukunftsunsicherheit, Identitätsverlust und Migration werden von rechtspopulistischen Demagogen instrumentalisiert. Ein Kennzeichen rechtspopulistischer Führer ist ihre Schamlosigkeit, sind Lügen und die Verletzung von Regeln des Anstands. 30Die grösste Gefahr für die Demokratie geht nach Strenger vom «Sturmangriff» auf die Wahrheit aus. 31
Das Feindbild der populistischen Führer sind die «abgehobenen» liberalen kosmopolitischen Eliten, welche die «historische Einheit» von Volk, Sprache und Staatsgebiet auflösen wollen. Eliten werden für den Verlust der Arbeitsplätze verantwortlich gemacht. Doch es ist nicht die Migration, sondern der wirtschaftliche Umbruch (wie Outsourcing oder Automatisierung), der zum Verlust der Arbeitsplätze führt. Diese an sich unentbehrlichen Eliten bringen den Anderen wenig Achtung entgegen, ja sie stempeln diese oft als rückständig und provinziell ab. Kultur- und Identitätsfragen spielen nach dieser Auffassung eine bedeutend grössere Rolle als die «Vernachlässigung» wirtschaftlich benachteiligter Klassen. Der populistische Nationalismus hat vielen Angehörigen sozioökonomisch schwächerer Schichten eine Stimme und ihren Stolz zurückgebracht. Diese hassen nun die Elite (Upward Contempt). Die kosmopolitischen Eliten sind in die Pflicht zu nehmen, weil kein Nationalstaat in der Lage ist, globale Herausforderungen wie Migration, Klima oder Terrorismus zu bewältigen.
Strenger plädiert für einen «klassischen» Liberalismus im Sinn der offenen Gesellschaft von Karl Popper, in der die Bürgerinnen und Bürger in Freiheit und Würde die öffentlichen Angelegenheiten «halbwegs rational» verwalten, mit Pressefreiheit, Forschungsfreiheit und unabhängiger Justiz, und in der es gilt, eine Tyrannei der Mehrheit zu verhindern.
Anne Applebaum geht der Frage nach, warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. Eine wichtige Rolle spielt nach ihrer Auffassung der von rechtsextremen nostalgischen Visionen eingefangene Wunsch, eine vermeintlich verlorene Heimat wiederaufzubauen. Sozialen Medien und Verschwörungstheorien kommt dabei eine grosse Bedeutung zu. 32
Zum Wandel der demokratischen Öffentlichkeit
Eine der grossen Herausforderungen der liberalen Demokratie stellt der Strukturwandel der Öffentlichkeit dar. Im Essay über die Freiheit (im zweiten Teil) versuche ich, Erscheinungen dieses Wandels, welche die Freiheit in der kommunikativen Öffentlichkeit bedrängen und gefährden, zu beleuchten. Die moderne Kommunikationstechnologie weist neben ihren unbestreitbaren Vorteilen mit dem Effekt der Echokammern auch gravierende Gefahren für die Demokratie auf, denn viele Individuen nutzen nur noch jene Sender, Kanäle und Websites, auf deren politischen Linie sie ohnehin bereits sind. Andersdenkende werden dämonisiert. Die Aufmerksamkeitsökonomie prämiert jene Stimmen, die mit provokanten Zitaten und Tweets aufwarten und die Gegenseite besonders aggressiv kritisieren, was zu einem eigentlichen Kulturkrieg führen kann. Das politische Klima wird von einer prekären Debattenkultur geprägt, was ich anhand von Cancel Culture und der politischen Korrektheit sowie der umstrittenen Identitätspolitik zu vertiefen suche. Liberale lassen sich in diesen Debatten nicht vereinnahmen, sondern setzen sich für eine grösstmögliche freie und offene Dialogkultur ein.
In einzelnen Demokratien ist der Respekt vor Andersdenkenden erodiert. Es ist ein Vertrauensverlust in grundlegende demokratische Mechanismen festzustellen, etwa in das Ergebnis von Wahlen und in repräsentative Entscheidungen, in eine für jede Demokratie essenzielle Kompromissbereitschaft sowie in demokratietypische langwierige Verfahren im Interesse einer deliberativen Rationalität. So fühlt sich ein beträchtlicher, aber schwer bezifferbarer Teil des Volkes von den gewählten Behörden nicht mehr vertreten. Diese heterogenen Bevölkerungsgruppen finden sich in ihrer generellen Ablehnung einer erweiterten Staatsmacht zusammen; sie sprengen die politische Links-rechts-Typologie. Denn sowohl «rechte» Querdenker und Ultraliberale sind hier anzusiedeln wie auch Linke, die jeglicher «Überwachung» durch den Staat abhold sind. Und Gleichgültige, die sich ihre «Alltagsfreiheit» (etwa die Durchführung von Partys oder den Verzicht des Maskentragens) nicht nehmen wollen. Die fortschreitende Dominanz elektronischer Kommunikation im Alltag hat den kollektiven Eindruck weiter intensiviert, nicht vertreten zu sein. Statt mehr Teilhabe an der politischen Öffentlichkeit ist mit den elektronischen Medien und ihren Echokammern mehr Absonderung und Einsamkeit eingetreten, was wiederum dem Populismus dienlich ist. 33Für die repräsentative Demokratie stellt es eine grosse Herausforderung dar, wie es gelingen kann, dass alle Schichten in der Politik repräsentiert werden. Direktdemokratische Elemente können, je nach Kultur und Entwicklungsstand, diesen Prozess unterstützen. Vor allem aber stellt sich – nicht nur, aber vor allem – in parlamentarischen Demokratien die Frage, ob institutionelle Veränderungen die Krise der Repräsentation zu beheben oder zu mildern vermögen. Müssten sich Liberale nicht an vorderster Front für solche Anliegen engagieren?
Der Aufsatz «Von den Säulen der Demokratie» geht auf die Repräsentationsproblematik sowie auf weitere Kernelemente der Demokratie ein. Das Volk der Demokratie ist nicht vorgegeben, sondern aufgegeben. Es bedarf auch in der Schweiz mit ihren Volksrechten der Repräsentation, einer doppelten sogar. Denn die jeweils entscheidende Volksmehrheit bei einer Abstimmung über Sachvorlagen stellt bloss eine Minderheit des Volkes dar. Diese «repräsentiert» somit das ganze Volk. Zudem und vor allem sind repräsentative Institutionen und eine unabhängige Justiz für jede Demokratie essenziell, was im Politalltag einer aktiven und von Bewegungen aller Art geprägten Zivilgesellschaft – jedenfalls in der Schweiz – oft ausgeblendet wird. Das Mehrheitsprinzip muss seine Grenzen an freiheitlichen Grundwerten finden. Minderheiten sind zu respektieren. Ein Blick auf den gegenwärtigen Initiativenbetrieb zeigt problematische Tendenzen für die rechtsstaatliche Demokratie auf.
Zur integrativen Funktion des Verfassungsstaats
Der Nationalstaat als Verfassungsstaat steht im Fokus des vierten Teils. Menschenwürdige Freiheit und Demokratie gründen im Verfassungsstaat. In historischer Sicht ist bemerkenswert, dass der Siegeszug der Freiheitsidee im Gefolge der Französischen Revolution durch die Nationalstaatenbildung ermöglicht, begleitet und gestärkt wurde. Es waren die neu entstandenen Staaten, welche einheitliche bürgerliche Rechts- und Wirtschaftsordnungen, liberale Strafrechtsideen sowie einen Parlamentsvorbehalt für «Freiheit und Eigentum» schrittweise, oft auch annäherungsweise eingeführt und teilweise durchgesetzt haben. Dieser Staat steht angesichts von Globalisierung und Internationalisierung grossen Herausforderungen wie Migration, Sicherheit und Klimawandel gegenüber. In neuster Zeit, nach den Erfahrungen in der Coronapandemie und angesichts zunehmender Naturkatastrophen, gewinnt der Nationalstaat wieder an Attraktivität, oft gepaart mit einem wieder erwachten Souveränitätsmythos. Doch vermögen Schwarz-Weiss-Bilder – auch hier – nichts zur Diskussion über die Funktion moderner Staaten beizutragen. Der moderne Staat stellt weder ein Auslaufmodell dar noch bedarf er einer Re-Nationalisierung. Die Grundwerte des freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaats bleiben auf den Staat angewiesen. Freilich ist dieser heute einem epochalen Strukturwandel unterworfen, indem seine autonome Handlungsfähigkeit verringert und der Lösungsbedarf für globale oder grenzüberschreitende Probleme gesteigert wird. Der einheitsgeprägte Nationalstaat muss deshalb das «Nationale» in den Hintergrund und seine Verfassung in den Vordergrund rücken, so meine These. Als Verfassungsstaat basiert er auf einer multiplen gesellschaftlichen und politischen Vielfalt; er hat die Integration «seiner» unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sowie deren Partizipation zu fördern sowie dem Bedürfnis der Menschen nach einer sich wandelnden Heimat positiv gegenüberzustehen. Das Ziel müssen entwicklungsfähige, binnendifferenzierte und integrative Verfassungsstaaten bilden, die auch zum Hort von Freiheit, Kultur und Frieden werden. Die Leistungen der Kultur für den Grundkonsens einer offenen, liberalen und vielfältigen Gesellschaft können kaum überschätzt werden. Gerade das Kreative und oft auch Anstössige in Kunst und Kultur bilden Brücken zu einem gemeinsinnigen Miteinander, zu Kohäsion und Kohärenz in der Gesellschaft. 34Dieses Bekenntnis zum Verfassungsstaat stellt keine Absage an Prozesse einer höherstufigen Integration dar, im Gegenteil. Ich meine aber, dass nur stabile Verfassungsstaaten das Fundament dauerhafter und erfolgreicher supranationaler Gemeinschaften zu bilden vermögen.
Читать дальше