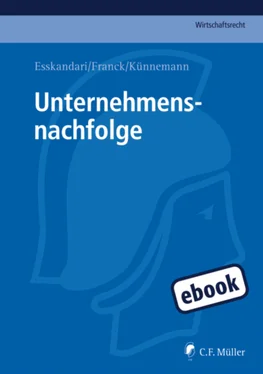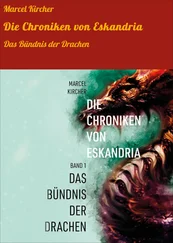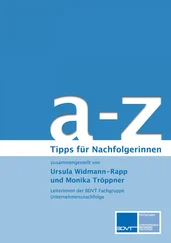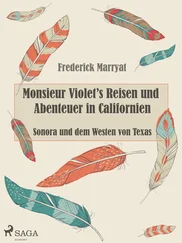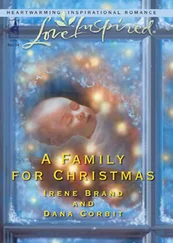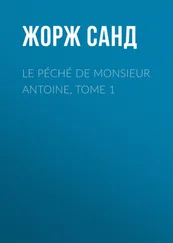3
Erfordert die Führung des Unternehmens besondere Befähigungen oder öffentlich-rechtliche Genehmigungennach der Gewerbeordnung, erlischt mit dem Tode des betreffenden Gewerbetreibenden die personengebundene Erlaubnis. Ausnahmen bestehen nach § 46 GewO für den überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner sowie für minderjährige Erben und für zur Nachlassverwaltung eingesetzte Personen. Das Fortführungsprivileg ist auf die genannten Personen beschränkt und gilt nur für das bestehende Gewerbe. Falls der Erbe die zur Fortführung des Betriebs erforderlichen persönlichen Befähigungen nicht aufweist, können die für den Betrieb erforderlichen Qualifikationen auch durch einen Stellvertreter sichergestellt werden, § 45 GewO. Bei den in § 47 GewO genannten Gewerben verlangt der Gesetzgeber besondere Qualifikationen, die eine spezielle Erlaubnis für die Stellvertretung voraussetzen. Schließlich kann die zuständige Behörde für eine Übergangszeit von einem Jahr nach § 46 Abs. 3 GewO gestatten, den Betrieb ohne Stellvertreter fortzuführen. Auch bei Fortführung eines Handwerkbetriebs besteht nach § 4 Abs. 1 HandwO ein Erbenprivileg.[5] Der Erbe darf den Betrieb fortsetzen, muss aber, sofern es sich um einen zulassungspflichtigen Handwerksbetrieb handelt, einen ausgeschiedenen Betriebsleiter unverzüglich ersetzen. Schafft der Erbe das nicht, muss gemäß § 13 HandwO die Löschung in der Handwerksrolle erfolgen, ohne dass es auf ein Verschulden ankäme. Weitere Besonderheiten bestehen für die Fortführung einer Gaststätte, § 10 GaststättenG, eines Schornsteinfegerhandwerks, § 21 SchfG, eines Verkehrsgewerbe, § 19 PBefG, § 8 GüKG, sowie eines Fahrlehrergewerbes, § 15 FahrlG.
4
Schließlich gehören auch Ansprüche aus einem Lebensversicherungsvertrag, die mit dem Tod fällig werden, nicht zum Nachlass, sofern der Erblasser einen Bezugsberechtigten im Wege des Vertrags zugunsten Dritter benannt hat.[6] Oftmals findet man bei Unternehmerehegatten die Konstruktion, dass der nicht-unternehmerisch tätige Ehegatte Versicherungsnehmer und Bezugsberechtigter der Versicherung auf das Leben des Unternehmerehegatten ist. In diesem Fall erwirbt der Nicht-Unternehmer-Ehegatte die Versicherungssumme erbschaftsteuerfrei.[7]
5
Praxishinweis:
In der Trennung zwischen Versicherungsnehmer und versicherter Person liegt ein Gestaltungsmodell zur erbschaftsteuerfreien Absicherung des Versicherungsnehmers, z. B. um die Zahlung der Erbschaftsteuer für den erbrechtlichen Erwerb des Einzelunternehmens zu ermöglichen. So könnte etwa die Nicht-Unternehmerehefrau eine hohe Lebensversicherung auf das Leben des Unternehmerehemanns abschließen, wäre also Versicherungsnehmerin und Bezugsberechtigte. Allenfalls die vom Ehemann gezahlten Prämien können schenkungsteuerpflichtig sein, sofern sie nicht unterhaltsrechtlich der Vorsorge der Ehefrau dienen.[8] Freilich muss darauf geachtet werden, dass die Versicherungssumme auch derjenige bekommt, der als Unternehmensnachfolger die Erbschaftsteuer zahlen muss. Bezugsberechtigung aus einem Lebensversicherungsvertrag und Unternehmertestament müssen also abgeglichen werden.
6
Der Erbe muss den Übergang des Unternehmens im Handelsregister anmelden, §§ 31 Abs. 1, 29 HGB. Das Registergericht kann die Anmeldung gemäß § 14 HGB erzwingen. Der Nachweis der Erbfolge erfolgt durch öffentliche Urkunden, § 12 Abs. 1 S. 3 HGB. Ergibt sich der Nachweis aus bei demselben Gericht geführten Akten – z. B. Erbschein oder notariell beurkundete Verfügung von Todes wegen in den Nachlassakten –, so kann darauf Bezug genommen werden.[9] Im Übrigen muss der Erbe den Nachweis durch eine Ausfertigung des Erbscheins oder durch eine Ausfertigung einer notariell beurkundeten Verfügung von Todes wegen samt Eröffnungsniederschrift führen.[10]
7
Formulierungsbeispiel:
Der im Handelsregister des Amtsgerichts … HRA … als Inhaber der Firma … eingetragene … ist am … verstorben.
Gemäß der beigefügten Ausfertigung des notariellen Testaments des Notars … in … vom … samt Eröffnungsniederschrift des Amtsgerichts … vom …, Az: VI …, wurde er von mir, dem Antragsteller, beerbt. Zur Eintragung in das Handelsregister melde ich an, dass ich das Geschäft unter der geänderten Firma … fortführe. Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich unverändert in … Unternehmensgegenstand ist …
8
Ein minderjähriger Erbekann das Einzelunternehmen ohne Genehmigung des Familiengerichts fortführen.[11] Allerdings kann er bei Eintritt der Volljährigkeit die Haftung für Verbindlichkeiten, die sein gesetzlicher Vertreter begründet hat, auf das bei Volljährigkeit vorhandene Vermögen beschränken, wenn er das Handelsgeschäft innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit einstellt, § 1629a Abs. 4 S. 2 BGB.[12]
9
Gemäß § 22 HGB kann der Erbe die Firma des Einzelunternehmens fortführen, wenn der bisherige Geschäftsinhaber in die Fortführung der Firma ausdrücklich einwilligt. Ob der Erbe die Firma auch ohne ausdrückliche Einwilligung des Erblassers fortführen darf, ist umstritten.[13] Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, eine ausdrückliche Einwilligungserklärung des Erblassers in sein Testament aufzunehmen. Bei Zuwendung des Handelsgeschäfts mittels Vermächtnis wird teilweise die Ansicht vertreten, dass neben der Zustimmung des Erblassers auch die der Erben notwendig sei.[14] Diese Auffassung lässt sich jedoch nicht mit dem eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 22 Abs. 1 HGB vereinbaren ( „… der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen Erben in die Fortführung der Firma ausdrücklich einwilligen ) und ist daher abzulehnen.
10
Formulierungsbeispiel:
Hiermit setze ich meinen Sohn … zu meinem alleinigen Erben ein.
Ich willige in die Fortführung der Firma meines in Neu-Ulm unter der Firma … e.K. betriebenen einzelkaufmännischen Unternehmens durch den Erben, mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes, ausdrücklich ein.
c) Haftung für Verbindlichkeiten
11
Was die Haftung des Erben für Verbindlichkeiten des Einzelunternehmers betrifft, muss unterschieden werden zwischen Alt- und Neuverbindlichkeiten auf der einen Seite sowie zwischen der bürgerlich-rechtlichen und der handelsrechtlichen Haftung auf der anderen Seite.
12
Für die im Geschäft vor dem Erbfall begründeten Altverbindlichkeitenhaftet der Erbe bürgerlich-rechtlichpersönlich unbeschränkt, §§ 1967 Abs. 2, 2058 ff. BGB. Diese Haftung kann der Erbe jedoch grds. auf das ererbte Vermögen durch Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenzverfahren (§§ 1975 ff. BGB) oder Erschöpfungs- und Dürftigkeitseinrede (§§ 1900 f. BGB) beschränken.
13
Neben der bürgerlich-rechtlichen Haftung für Verbindlichkeiten eines kaufmännischen Einzelunternehmens besteht als lex specialis die handelsrechtliche Haftungdes Erben nach § 27 HGB. Danach haftet der Erbe für Altverbindlichkeiten voll und unbeschränkt, sofern er ein zum Nachlass gehörendes Handelsunternehmen unter der bisherigen Firma[15] mit oder ohne Beifügung eines Nachfolgezusatzes fortführt (oder ein besonderer Verpflichtungsgrund nach §§ 27, 25 Abs. 3 BGB besteht). Der Erbe kann seine handelsrechtliche Haftung durch drei Maßnahmen beschränken:
14
Er stellt das zunächst fortgeführte Unternehmen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis vom Anfall der Erbschaft ein, § 27 Abs. 2 HGB. Umstritten ist, welche Maßnahmen der Erbe ergreifen muss, um das Unternehmen einzustellen. Nach der überzeugenden, vordringenden Auffassung ist entscheidend, dass der Erbe die Unternehmensträgerschaft aufgibt, d.h. der Erbe selbst das Unternehmen nicht mehr fortführt.[16] Nach dieser Ansicht könnte der Erbe das ererbte Unternehmen also etwa dadurch einstellen, dass er es an einen Dritten veräußert, verpachtet oder in eine von ihm gegründete Handelsgesellschaft, z. B. KG, einbringt. Die wohl noch herrschende Meinung hingegen verlangte, dass das Geschäft selbst eingestellt werden muss, um die Haftungsbeschränkung nach § 27 Abs. 2 HGB zu erreichen.[17] Nicht ausreichend ist nach beiden Ansichten, dass das Unternehmen durch einen Bevollmächtigten fortgeführt wird, wie etwa einen Prokuristen oder einen Testamentsvollstrecker bei der Vollmachtslösung (vgl. Rn. 222).[18] Ausreichend für eine Einstellung ist nach beiden Ansichten hingegen die Herausgabe des Unternehmens an den Nachlassinsolvenzverwalter innerhalb der Frist des § 27 Abs. 2 HGB, den Nachlassverwalter, an den Testamentsvollstrecker im Fall der Treuhandlösung (vgl. Rn. 228) oder an einen Vermächtnisnehmer.[19] Nach der Einstellung darf der Erbe keine neuen Geschäfte abschließen oder Verbindlichkeiten begründen. Unberührt bleiben die Abwicklung der vor der Einstellung begründeten Geschäfte, insbesondere die Erfüllung von Verbindlichkeiten und die Einziehung von Forderungen.
Читать дальше