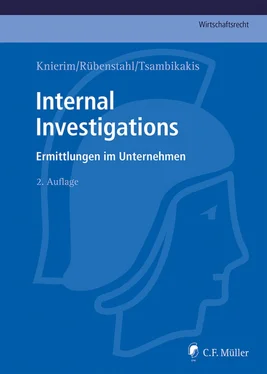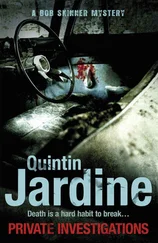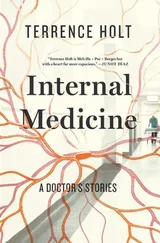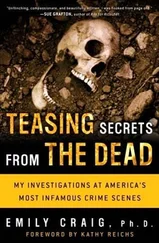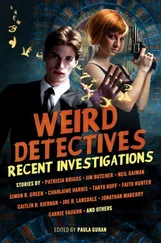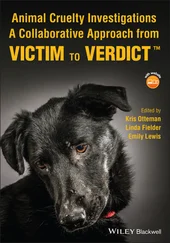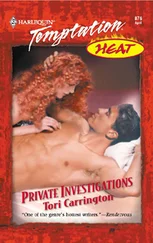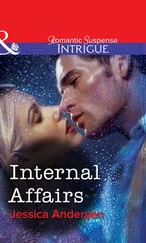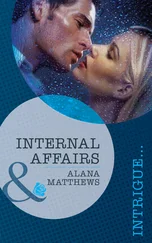[2]
Vgl. Patzak/Rattay S. 143; Litke Kap. 2.1, S. 63.
[3]
Zu diesem, dem instrumentellen Organisationsbegriff innewohnenden Ziel vgl. Wöhe/Döring Kap. B.IV.1, S. 109.
[4]
Vgl. Drees/Lang/Schöps Kap. 3.1, S. 10.
[5]
Vgl. IPMA COMPETENCE BASELINE Version 3.0, in der Fassung als DEUTSCHE NCB 3.0 NATIONAL COMPETENCE BASELINE der PM-ZERT Zertifizierungsstelle der GPM e.V., unter Gliederungspunkt 4.1.6. Projektorganisation, S. 63, abrufbar unter www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Qualifizierung_Zertifizierung/Zertifikate_fuer_PM/National_Competence_Baseline_R09_NCB3_V05.pdf, Stand 20.4.2016.
[6]
Vgl. Litke Kap. 2.1, S. 63.
[7]
Wöhe/Döring Kap. B.IV.1, S. 110.
[8]
Vgl. Patzak/Rattay S. 172 ff.; Litke Kap. 2.3, S. 69 ff.; Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Kap. 2.6, S. 106 ff.
[9]
Daneben nennen Patzak/Rattay S. 175, noch die sog. Pool-Organisation, die jedoch nicht durch ein Nebeneinander von Projekt- und Stammorganisation gekennzeichnet ist; vielmehr ist die permanente Organisation des Unternehmens insgesamt in Form einer reinen Projektorganisation aufgebaut. Wöhe/Döring Kap. B.IV.2, S. 124 führen zusätzlich noch die sog. Kollegienlösung auf. Zu organisatorischen Lösungsansätzen eines Multiprojektmanagements vgl. außerdem Litke Kap. 2.3.4, S. 80.
[10]
Nach Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Abb. III-6, S. 107.
[11]
Vgl. Litke Kap. 2.3.1.3, S. 71.
[12]
Vgl. Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Kap. 2.6.1, S. 108.
[13]
Nach Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Abb. III-7, S. 108.
[14]
Nach Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Abb. III-8, S. 109.
[15]
Vgl. Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Kap. 2.6.3, S. 110; ähnlich Litke Kap. 2.3.1.4, S. 73.
[16]
Vgl. zur Definition der Aufbauorganisation einer Unternehmensorganisation Wöhe/Döring Kap. B.IV.1, S. 110; im Folgenden dort auch Darstellung der allgemeinen Vorgehensweise.
[17]
Vgl. Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Kap. 2.3, S. 100.
[18]
Vgl. Patzak/Rattay S. 85 ff.
[19]
Eine vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebene interne Untersuchung ist auf Basis des § 111 Abs. 2 AktG vorstellbar.
[20]
Vgl. IPMA COMPETENCE BASELINE Version 3.0, in der Fassung als DEUTSCHE NCB 3.0 NATIONAL COMPETENCE BASELINE der PM-ZERT Zertifizierungsstelle der GPM e.V., unter Gliederungspunkt 4.2 PM-Verhaltenskompetenz-Elemente, S. 94 ff., abrufbar unter www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Qualifizierung_Zertifizierung/Zertifikate_fuer_PM/National_Competence_Baseline_R09_NCB3_V05.pdf, Stand 20.4.2016.
[21]
Vgl. Litke Kap. 5.2.1, S. 165 f.
[22]
IPMA COMPETENCE BASELINE Version 3.0, in der Fassung als DEUTSCHE NCB 3.0 NATIONAL COMPETENCE BASELINE der PM-ZERT Zertifizierungsstelle der GPM e.V., unter Gliederungspunkt 4.1.12 Ressourcen, S. 75, abrufbar unter www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Qualifizierung_Zertifizierung/Zertifikate_fuer_PM/National_Competence_Baseline_R09_NCB3_V05.pdf, Stand 20.4.2016.
[23]
Vgl. dazu ausführlich Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Kap. 4.3.3, S. 166 ff.
[24]
Vgl. IPMA COMPETENCE BASELINE Version 3.0, in der Fassung als DEUTSCHE NCB 3.0 NATIONAL COMPETENCE BASELINE der PM-ZERT Zertifizierungsstelle der GPM e.V., unter Gliederungspunkt 4.1.7 Teamarbeit, S. 65, abrufbar unter www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Qualifizierung_Zertifizierung/Zertifikate_fuer_PM/National_Competence_Baseline_R09_NCB3_V05.pdf, Stand 20.4.2016.
[25]
IPMA COMPETENCE BASELINE Version 3.0, in der Fassung als DEUTSCHE NCB 3.0 NATIONAL COMPETENCE BASELINE der PM-ZERT Zertifizierungsstelle der GPM e.V., unter Gliederungspunkt 4.1.7 Teamarbeit, S. 65, abrufbar unter www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Qualifizierung_Zertifizierung/Zertifikate_fuer_PM/National_Competence_Baseline_R09_NCB3_V05.pdf, Stand 20.4.2016.
[26]
Vgl. ausführlicher dazu Patzak/Rattay S. 183 ff.
[27]
Vgl. Patzak/Rattay S. 183; Litke Kap. 5.3.3, S. 181 f. m.w.N.
[28]
Vgl. Patzak/Rattay S. 189 ff.
[29]
Zu den in diesem Zusammenhang veränderten Anforderungen an die Einstellungen und Verhaltensweisen aller beteiligten Teammitglieder vgl. weiterführend Patzak/Rattay S. 190-193.
[30]
Als strukturierte (elektronische) Daten werden bspw. Daten aus den Buchhaltungssystemen bezeichnet. Im Unterschied dazu werden solche Daten, die in Dateiordnern auf Festplatten von Computern, externen Datenträgern, File-Servern oder E-Mail-Servern abgelegt sind, als unstrukturiert bezeichnet.
[31]
Vgl. Wöhe/Döring Kap. B.IV.3, S. 124.
[32]
Vgl. ICB = IPMA COMPETENCE BASELINE Version 3.0, in der Fassung als DEUTSCHE NCB 3.0 NATIONAL COMPETENCE BASELINE der PM-ZERT Zertifizierungsstelle der GPM e.V., unter Gliederungspunkt 4.1.9. Projektstrukturen, S. 69, abrufbar unter www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_upload/Qualifizierung_Zertifizierung/Zertifikate_fuer_PM/National_Competence_Baseline_R09_NCB3_V05.pdf, Stand 20.4.2016.
[33]
Drees/Lang/Schöps Kap. 6.2, S. 45.
[34]
Zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Herleitung eines solchen Projektstrukturplanes – u.a. Zerlegungsmethode (top down) und Zusammensetzungsmethode (bottom up) – vgl. Patzak/Rattay S. 224 ff.
[35]
Zu den unterschiedlichen Terminplanungsmethoden siehe Übersicht bei Patzak/Rattay S. 249 ff.
[36]
Patzak/Rattay S. 341.
[37]
Vgl. dazu ausführlich Kuster/Huber/Lippmann/Schmid/Schneider/Witschi/Wüst Kap. 2.8, S. 112 f.; Patzak/Rattay S. 169 ff.; zum Konflikt um sog. „Informationsinseln“ siehe Rn. 20.
[38]
Deutsches Institut für Interne Revision (IIR), IIR Revisionsstandard Nr. 1, Zusammenarbeit von Interner Revision und Abschlussprüfer.
1. Teil Ermittlungen im Unternehmen› 4. Kapitel Projektorganisation, Projektplanung, Projektsteuerung und Reporting› III. Projektplanung und -steuerung
III. Projektplanung und -steuerung
87
Unternehmen werden heute aufgrund des raschen technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels zunehmend vor Aufgaben gestellt, die sich mit bestehenden Strukturen oder im laufenden Tagesgeschäft nicht oder zumindest nicht schnell und effektiv genug lösen lassen. Das Projektmanagement als Unternehmen auf Zeit hat sich als interdisziplinäre Führungsform für die Abwicklung solch komplexer, weitgehend einmaliger, zeitkritischer und innovativer Aufgaben besonderer Bedeutung sehr bewährt. Gerade „Interne Untersuchungen“ können – wie eingangs dargestellt – eine spezielle Planung, Steuerung, Organisation und Kontrolle verlangen.
88
Die Projektplanungist ein Hauptbestandteil der Projektabwicklung. Neben der Aufgabenplanung und der Terminplanung ist die Ressourcen- und Kostenplanung das dritte Standbein einer integrierten Projektplanung.
89
Gerade bei „Internen Untersuchungen“, die mit großer Unsicherheit behaftet sind, ist eine gründliche Planung ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Gelingen, da sie für die Koordination der Projektaufgaben und für die Abschätzung der benötigten Ressourcen und der Zeit wesentlich ist. Die Projektplanung ist jedoch keine einmalige Aufgabe, sondern ein permanenter Prozess, da der genaue Projektablauf oft noch kaum abschätzbar ist. In der Praxis hat sich die rollierende Planungbewährt – es wird mit einer Grobplanung begonnen und die jeweils anstehende Phase wird dann detailliert geplant. Somit fließen Erkenntnisse aus der Realisierung einer Phase direkt in die Detailplanungen der nächsten Phase(n) ein.
Читать дальше