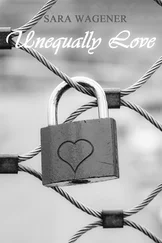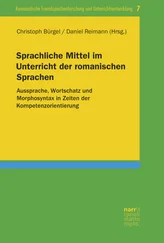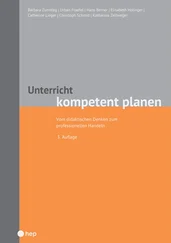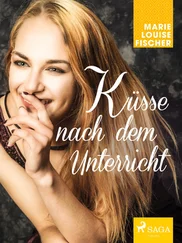Der jahrgangsübergreifende Unterricht war seit der Gründung der Grundschule immer wieder verschiedenen Strömungen und Wandlungen unterworfen, die im folgenden Kapitel anhand prägnanter Zeitabschnitte nachvollzogen werden. Die Zeit der Gründung der Grundschule bildet den historischen Ausgangspunkt (  Kap. 2.1), gefolgt von Überlegungen zur Frage, welche Bedeutung die Grundschule als Unterstufe der Volksschule für die Jahrgangsmischung hatte (
Kap. 2.1), gefolgt von Überlegungen zur Frage, welche Bedeutung die Grundschule als Unterstufe der Volksschule für die Jahrgangsmischung hatte (  Kap. 2.2). Als wichtige Zäsur werden reformpädagogische Konzepte betrachtet, in denen Jahrgangsmischung pädagogisch begründet wurde (
Kap. 2.2). Als wichtige Zäsur werden reformpädagogische Konzepte betrachtet, in denen Jahrgangsmischung pädagogisch begründet wurde (  Kap. 2.3). In der Zeit des Nationalsozialismus war die Jahrgangsmischung in Bezug auf das Erreichen staatskonformer Erziehungsziele bedeutend (
Kap. 2.3). In der Zeit des Nationalsozialismus war die Jahrgangsmischung in Bezug auf das Erreichen staatskonformer Erziehungsziele bedeutend (  Kap. 2.4) und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl in der neu gegründeten Deutschen Demokratischen Republik als auch später in der Bundesrepublik als rückständig betrachtet (
Kap. 2.4) und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl in der neu gegründeten Deutschen Demokratischen Republik als auch später in der Bundesrepublik als rückständig betrachtet (  Kap. 2.5). Im Anschluss werden die aktuellen Entwicklungen dargelegt (
Kap. 2.5). Im Anschluss werden die aktuellen Entwicklungen dargelegt (  Kap. 2.6), bevor das Kapitel mit einem Zwischenfazit (
Kap. 2.6), bevor das Kapitel mit einem Zwischenfazit (  Kap. 2.7) abgeschlossen wird.
Kap. 2.7) abgeschlossen wird.
2.1 Die Gründungszeit der Grundschule als Ausgangspunkt für Jahrgangsmischung
Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit jahrgangsübergreifendem Unterricht in der Grundschule wird von ihrer Gründung im Jahr 1919 ausgegangen. Zunächst wurde die Grundschule nicht als eigenständige Institution gegründet, sondern umfasste die vier unteren Jahrgänge der Volksschule. Diese wiederum war eine Einrichtung aus der Kaiserzeit, die weitergeführt wurde. Die systemische Verbindung von Grundschule und Volksschule blieb bis 1964 bestehen, wie auch im Reichsgrundschulgesetz von 1920 ersichtlich wird: »Die Volksschule ist in den vier untersten Jahrgängen als die für alle gemeinsame Grundschule, auf der sich auch das mittlere und höhere Schulwesen aufbaut, einzurichten.« 2 Erst 1964 wurde die Grundschule zur eigenständigen Institution, unabhängig von der Hauptschule (vgl. Götz 2019, 40).
Als »die für alle gemeinsame Grundschule« sollte sie Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft eine erfolgreiche Schullaufbahn gewähren. Allerdings wurde dieser Anspruch von Anfang an nur teilweise eingelöst. Aufgrund des Kriteriums der Schulfähigkeit, die sich nicht nur auf den Schulanfang bezieht, konnte und kann die Grundschule keine »für alle gemeinsame Schule« sein, als welche sie ursprünglich bezeichnet wurde. Denn die Selektion von nicht schulfähigen Kindern vor dem Eintritt in die Grundschule (im Reichsschulpflichtgesetz von 1938 gesetzlich verankert 3 ) zeigt sich bis heute insbesondere in Form einer erheblichen Anzahl an Zurückstellungen vom Schulbesuch (vgl. Pape 2016, 104). Darüber hinaus erfuhr die Einrichtung von Hilfs- bzw. Sonderschulen in der Zeit der Weimarer Republik und insbesondere in der NS-Zeit einen erheblichen Gewinn durch ihren Ausbau im Rahmen eines eigenständigen Sonderschulwesens (vgl. Hänsel 2006). Diese Einschränkungen des Anspruchs der Grundschule als Einheitsschule wurden in der Erziehungswissenschaft bisher eher randständig thematisiert. Nach Herrlitz, Hopf und Titze (1998, 126) kann die Grundschule verstanden werden als Schule, in der »die strikte Segregation von höherer und niederer Bildung – allerdings nicht die von ›Normalschulen‹ und ›Hilfsschulen‹ für geistig und körperlich Behinderte – durchbrochen« wird. Diese Aussage ist bis heute zutreffend.
2.2 Jahrgangsmischung in der Grundschule als Unterstufe der Volksschule
Als Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Jahrgangsmischung ist der schon erwähnte Zusammenhang von Grundschule und Volksschule zu betrachten. Die Grundschule wurde nicht als eigenständige Institution eingerichtet, sondern umfasste die vier unteren Jahrgänge der Volksschule. Somit war sie auch der standortabhängigen Gliederung unterworfen und damit sehr unterschiedlichen Bedingungen in der Stadt und auf dem Land. Die Mehrzahl der preußischen Volksschulen befand sich auf dem Land und war überwiegend jahrgangsübergreifend (ein- und zweiklassig) organisiert, während die städtischen Volksschulen mehrheitlich in Jahrgangsklassen gegliedert waren.
Die Unterrichtsbedingungen waren also sehr unterschiedlich, da insbesondere auf dem Land sehr ungünstige Rahmenbedingungen vorherrschten. Beklagt wurden vom Deutschen Lehrerverein in der Denkschrift »Die Landschule« von 1926 vor allem die unzureichende Ausstattung an Personal und Lehrmitteln an den Schulen sowie die zu hohe Schülerzahl pro Klasse. Die Beurteilung der Lernentwicklung der einzelnen Kinder fiel überwiegend negativ aus, da zu wenige Unterstützungsmaßnahmen auf dem Land vorhanden waren. Hinsichtlich der aus Ressourcenmangel begründeten jahrgangsübergreifenden Unterrichtsgestaltung wurden didaktische Fragen der Unterrichtsdifferenzierung jedoch kaum gestellt und fanden sich auch nicht in den preußischen Richtlinien (vgl. Pape 2016, 110). Da eine spezielle Didaktik fehlte, wurde entsprechend einer vom Jahrgangsklassensystem bestimmten Abteilungsgliederung aus der Zeit des Kaiserreichs unterrichtet, obwohl einige Kritikpunkte angeführt wurden. Diese bezogen sich darauf, dass Lehrkräfte zu wenig Zeit zur Anleitung und gemeinsamen Erarbeitung von Unterrichtsgegenständen mit den Kindern hatten, sodass es sich bei den Lehrprozessen eher um »Methoden des Einpaukens« (ebd., 145) handelte.
Eine Abkehr vom Abteilungsunterricht innerhalb jahrgangsübergreifender Klassen wurde in reformpädagogischen Ansätzen deutlich, in denen didaktische Prinzipien wie das Ganzheits- und Gemeinschaftsprinzip, die Selbsttätigkeit des Kindes und das Lernen durch praktisches Tun zum Ausdruck gebracht wurden. Im Folgenden werden prägnante Ansätze aus reformpädagogischer Perspektive in Bezug auf Jahrgangsmischung skizziert.
2.3 Jahrgangsmischung aus reformpädagogischer Sicht
Aus reformpädagogischer Sicht entwickelten sich Konzepte, die sich mit pädagogischen Argumenten für die Jahrgangsmischung aussprachen. Sie können als Gegenmodell zur Volksschuldidaktik betrachtet werden, in der die jahrgangsübergreifende Klassenbildung gezwungenermaßen aus fehlenden räumlichen und personellen Ressourcen resultierte.
Als prominente Vertreterin und Vertreter sind Maria Montessori (1870–1952), Peter Petersen (1884–1952) und Berthold Otto (1859–1933) zu nennen, die das Jahrgangsklassensystem kritisierten und sich konzeptionell sehr ausführlich zur Jahrgangsmischung äußerten. Die Jahrgangsklasse wurde als eine »unnatürlich« zusammengesetzte Lerngruppe betrachtet, da nirgendwo anders als in der Schulklasse Gruppen in Jahrgängen zusammengesetzt sind.
Maria Montessori, italienische Ärztin (erste Frau, die Medizin studieren konnte) und Pädagogin, betrachtete Jahrgangsmischung als natürliche Umgebung, ähnlich der Altersstruktur in der Familie. Sie plädierte für die Mischung von drei Jahrgängen, begründete dies aber nicht explizit (vgl. Montessori 1972, 86). Die Kombination dieser Altersstufen erweist sich Maria Montessori zufolge als Förderung der Entwicklung des Kindes:
Читать дальше
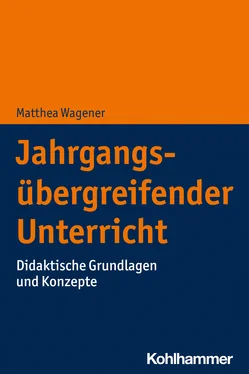
 Kap. 2.1), gefolgt von Überlegungen zur Frage, welche Bedeutung die Grundschule als Unterstufe der Volksschule für die Jahrgangsmischung hatte (
Kap. 2.1), gefolgt von Überlegungen zur Frage, welche Bedeutung die Grundschule als Unterstufe der Volksschule für die Jahrgangsmischung hatte (