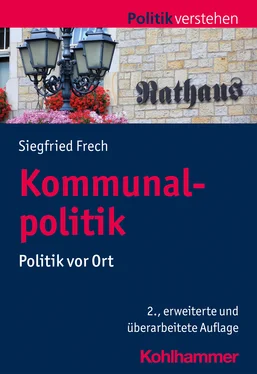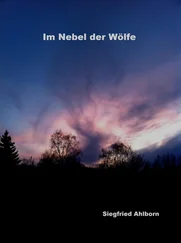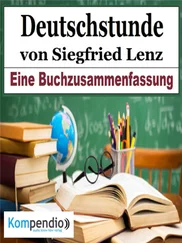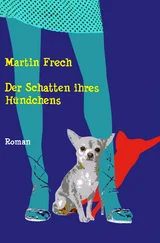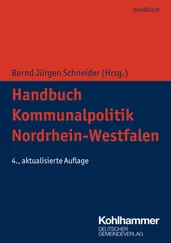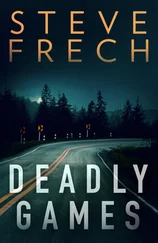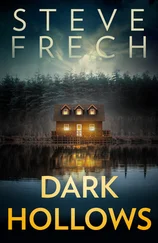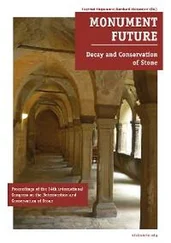Die Unterbringung von Flüchtlingen erfolgte zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes. Es zeichnete sich im Herbst 2015 rasch ab, dass die 1000 Plätze in der 1990 eingerichteten Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Karlsruhe, die bis 2014 Zentrale Anlaufstelle (ZASt) hieß, nicht reichen würden. Bereits Ende 2014 konnten in drei weiteren Erstaufnahmeeinrichtungen (Meßstetten, Heidelberg und Mannheim) Flüchtlinge aufgenommen werden. Im Laufe des Jahres 2015 erhöhte sich die Zahl der Erstaufnahmestellen auf 22. Leerstehende Kasernen, Fabrik- und Turnhallen und andere Gebäude wurden mit Unterstützung der Wohlfahrtsverbände und mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen in Notunterkünfte umgewandelt. Das Integrationsministerium Baden-Württemberg berichtete beispielsweise, dass eine Gemeinde eine leer stehende Fabrikhalle anbot, in der bereits am Abend die ersten Flüchtlinge einziehen konnten – dank der Unterstützung von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk und anderen Ehrenamtlichen (Stuttgarter Nachrichten, 29.9.2016).
Weil Länder und Kommunen die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten eigenverantwortlich und abhängig von den ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln organisierten, war die Lage anfangs von Ort zu Ort unterschiedlich. Während in manchen Großstädten Zeltstädte im Matsch versanken und Tausende über Monate hinweg in Turnhallen untergebracht waren, gelang es anderen Kommunen, die Flüchtlinge in Wohnungen, Kasernen, angemieteten Hotels oder Leichtbauhallen unterzubringen.
In den Landeserstaufnahmestellen (LEA) erfolgt aufgrund des gestellten Asylantrags die Erstanhörung. An die Landeserstaufnahmestellen sind Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angeschlossen, die die Erstanhörung durchführen. Nach einer Aufenthaltsdauer von sechs bis zwölf Wochen werden Asylbewerber zunächst auf die Landkreise und danach auf die Kommunen verteilt. Auch diese Verteilung erfolgt nach einem Quotensystem. Im September 2016 warteten etwa 104.000, zumeist in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Personen auf eine Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Von Januar bis Juli 2016 entschied das BAMF insgesamt 40.339 Asylanträge aus Baden-Württemberg. Sobald Flüchtlinge als Asylsuchende anerkannt werden und ihnen das Bleiberecht zugesprochen wird, sind die Kommunen gefordert. Diese sogenannte Anschlussunterbringung fällt in die Zuständigkeit der Städte und Gemeinden. Vor Ort erfolgen auch die ersten Schritte in Richtung Integration. Die kommunalen Maßnahmen sind hierbei vielfältig: Hierzu gehören z. B. Sprach- und Integrationskurse, die schulische Integration, Jugend- und Sozialarbeit, die Unterbringung in Wohnungen und die Integration in den lokalen bzw. regionalen Arbeitsmarkt. Angesichts dieser Anschlussunterbringungen mahnte der Gemeindetag nach der Landtagswahl 2016 und den Koalitionsverhandlungen beim Land finanzielle Unterstützung für die Städte und Gemeinden an (Stuttgarter Nachrichten, 25.6.2016). Immerhin erhielt Baden-Württemberg für die Integration der Flüchtlinge bis 2018 jährlich 260 Millionen Euro zusätzlich vom Bund. Laut einer Bundestagsdrucksache (Mai 2021) hat der Bund Länder und Kommunen im Jahr 2020 im Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten mit rund 3,7 Milliarden unterstützt.
Außerdem hat der Bund im Jahr 2020 weitere Ausgaben in Höhe von ca. 18,8 Milliarden Euro getragen, an denen sich die Länder nicht beteiligen.
Im Frühjahr 2016 trat eine merkliche Wende ein. Der anhaltende Zustrom von Flüchtlingen stellte die EU vor eine Zerreißprobe. Anstatt Kooperation waren nationale Egoismen angesagt. Man stritt über Zuständigkeiten und versuchte durch einseitige Grenzschließungen und Einschränkungen Flüchtlinge auf die Nachbarstaaten abzuwälzen. Die Flüchtlinge waren vielfach in Lagern mit schlechter Versorgung untergebracht oder mussten im Freien campieren. Einige Staaten in Mittel- und Osteuropa (Rumänien, die Slowakei, Tschechien, Polen und Ungarn) weigerten sich grundsätzlich, Flüchtlinge aufzunehmen oder zu versorgen. Makedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien ließen keine von Griechenland kommenden Flüchtlinge mehr über die Grenze. Auch Österreich schloss seine Grenzen. Nach mehreren Verhandlungsrunden trat im März 2016 ein Abkommen zwischen der EU und der Türkei in Kraft: In dem Abkommen verpflichtete sich die Türkei, alle Flüchtlinge aus Griechenland zurückzunehmen, die ab dem 20. März 2016 irregulär über ihr Staatsgebiet in die EU eingereist sind. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, für jeden syrischen Flüchtling, der von der Türkei zurückgenommen wird, einen anderen, in der Türkei registrierten und damit anerkannten Flüchtling auf legalem Weg aufzunehmen. Damit wollte man Anreize für Flüchtlinge schaffen, sich gar nicht erst in die Hände von Schleppern und auf die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer zu begeben. Denn wer zurückgeschickt wird, hat keine Chance mehr auf eine legale Einwanderung in die EU.
Und wie sah es im Land selbst aus? Die Zeit, in der Kuscheltiere am Bahnhof verteilt wurden, schien vorbei zu sein. In den Leserbriefspalten der Zeitungen war von »Asylchaos«, »Notstand«, »Flüchtlingswellen« und dringend gebotenen »Obergrenzen« die Rede, manche beschworen sogar den Untergang des Abendlandes herbei. (Das in der Verfassung verankerte Grundrecht auf Asyl ist nicht verhandelbar und kennt daher auch keine Obergrenze.) Die Übergriffe auf Flüchtlinge und Attacken auf deren Unterkünfte stiegen merklich an. Das Bundeskriminalamt (BKA) zählte 2015 offiziell 1005 Straftaten gegen Flüchtlingsheime, darunter auch Brandanschläge. 2016 ereigneten sich knapp 1000 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte.
Die Bevölkerung war in ihrer Haltung gespalten. Im März 2016 waren 55 Prozent der Deutschen der Meinung, Deutschland könne die vielen Flüchtlinge verkraften (ZDF-Politikbarometer, 18.3.2016). Der Anteil derjenigen, der in der Zuwanderung Vorteile sah, war mit 38 Prozent recht hoch, während ein ähnlich hoher Anteil von 41 Prozent eher Nachteile sah (ARD-Deutschlandtrend, Januar 2016). Ebenso glaubten 41 Prozent zuversichtlich an die Integration der Flüchtlinge (ZDF-Politikbarometer, 19.2.2016). Einer knappen Mehrheit, die positiv gegenüber den Flüchtlingen eingestellt war, stand eine knappe Minderheit gegenüber, die skeptisch bis negativ gestimmt war. Dies machte sich die Alternative für Deutschland (AfD) zunutze, die in mehreren Landtagskämpfen mit den Themen Flüchtlinge und Innere Sicherheit auf Stimmenfang ging. 2016 gelang ihr in vier Ländern (Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern) sowie bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus der Einzug in die Länderparlamente.
2017 bekam die Willkommenskultur weitere Kratzer. Eine knappe Mehrheit von 54 Prozent der Bundesbürger sah Deutschland einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge bei der Aufnahme weiterer Flüchtlinge an der »Belastungsgrenze« angekommen. Insbesondere in den neuen Ländern schien die Skepsis zuzunehmen. Dort waren der Umfrage zufolge nur noch 33 Prozent der Bürger nach eigenen Angaben davon überzeugt, dass die Gesellschaft Flüchtlingen »offen« aufnehme. Im Westen waren mit 65 Prozent etwa doppelt so viel Befragte dieser Meinung. Ebenso stieg der Anteil derer, die zusätzliche Belastungen für den Sozialstaat erwarten auf 79 Prozent. 65 Prozent waren der Meinung, Einwanderung verschärfe die Wohnungsnot in den Ballungszentren (Stuttgarter Nachrichten, 11.4.2017).
Integration bleibt ein Hauptthema der kommenden Jahre
Seit März 2016 kamen spürbar weniger Flüchtlinge nach Deutschland. So kamen im August 2016 nur noch 1782 Asylsuchende nach Baden-Württemberg. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Zahlen drastisch ab: Im August 2015 kamen noch 8991 Neuankömmlinge im Südwesten an. Laut Innenministerium blieben von Januar bis August 2016 rund 26.500 Flüchtlinge nach ihrem Erstantrag in Baden-Württemberg. Zugleich schob Baden-Württemberg abgelehnte Asylbewerber verstärkt ab. Im ersten Halbjahr 2016 wurden 1663 abgelehnte Asylbewerber zwangsweise in ihre Herkunftsländer zurückgeführt.
Читать дальше