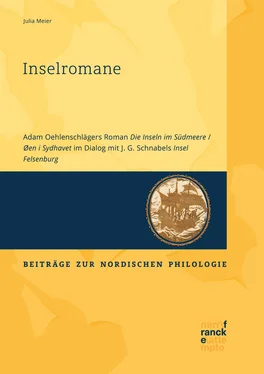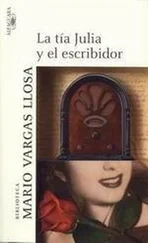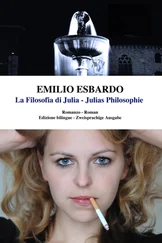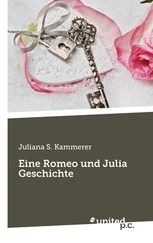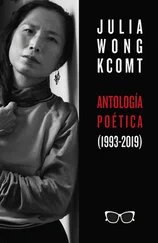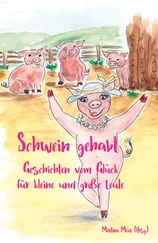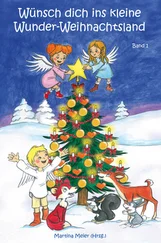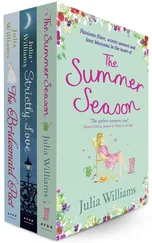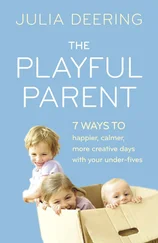Eberhard schifft sich mit Kapitän Horn nach Europa ein, um seinen Vater und seine Schwester zu suchen und mit ihnen zur Felsenburg zurückzukehren. Unter grossen Mühen und Anstrengungen – die Schwester muss aus einer erzwungenen Verlobung freigekauft werden – gelingt es Eberhard, alle Verhältnisse soweit zu ordnen, dass er mit Vater und Schwester nach Amsterdam reisen kann, wo ihn Kapitän Horn zur Einschiffung nach der Felsenburg erwartet. Vor der Abreise sorgt Eberhard noch dafür, dass sein Manuskript in Druck gegeben wird, und verspricht eine Fortsetzung. Ein Anhang, bestehend aus einigen Briefen, orientiert andeutungsweise über die Reise nach Amsterdam und letzte Vorbereitungen auf die Abreise von Europa.

Abb. 8: Titelblatt und Frontispiz der Erstausgabe des 3. Teils der Wunderlichen Fata.
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Lo 6958. © Verlag Zweitausendeins
Das Titelblatt des dritten Teils, mit den gleichen graphischen und farblichen Elementen gestaltet wie die vorhergehenden Titelblätter, erwähnt Alberts Tod im Alter von 103 Jahren. Diese in kleiner, unauffälliger Schrift gedruckte Mitteilung erhält besondere Aufmerksamkeit durch das beigefügte Frontispiz, welches in der oberen Hälfte das Grabmonument für Albert Julius mit dessen Lebensdaten zeigt, während die untere Hälfte seinen von neun Kerzen umstandenen Sarg abbildet.5 Alberts Sterben, das sich über mehrere Seiten hinzieht, ereignet sich ungefähr in der Mitte des dritten Teils, steht also in dessen Zentrum. Nach Alberts Beerdigung wird die Grabpyramide, die der Leser schon vom Frontispiz her kennt, errichtet und mit mehreren Symbolen und lobpreisenden Inschriften in lateinischer, deutscher und englischer Sprache geschmückt. Wenig später begeben sich Eberhard und seine Freunde auf die Insel Klein-Felsenburg, wo ihnen seltsame Phänomene erscheinen, wie Flammen und Feuerkugeln, begleitet von schrecklichen Stimmen, die Unverständliches sprechen. Sie finden zehn steinerne Urnen mit rätselhaften Zeichen und Figuren, später einen Tempel mit zwölf goldenen Götzenbildern sowie eine grosse Zahl von beschriebenen Tafeln aus Stein, Kupfer und Gold. Alles wird auf die grosse Felseninsel gebracht, wo man nach längeren Diskussionen auf den Rat Pfarrer Schmeltzers beschliesst, die Tafeln zur Entzifferung nach Europa zu senden. Erstmals wird nun auf der Insel Klein-Felsenburg erzählt, was auch sie zu einem Erzählraum macht.
Kapitän Horn reist mit verschiedenen Aufträgen wieder nach Europa, u.a. soll er eine voll ausgerüstete Druckerei samt allen dafür benötigten Fachleuten auf die Insel bringen, auch soll er die Tafeln der Insel Klein-Felsenburg entziffern lassen und Eberhards Manuskript des dritten Teils der WF an Gisander übergeben. Dieser fährt nun anstelle von Eberhard, dessen Manuskript ja abgeschlossen ist, mit der Erzählung fort; er berichtet, dass Kapitän Horn seine Redaktion der beiden bisherigen Bände gelobt und ihn gebeten habe, ihm den dritten Teil vorzulesen, wobei Horn das Manuskript stellenweise verbessert habe. Es folgt – von Gisander aufgezeichnet – der Bericht Horns, wie er versuchte, jemanden zu finden, der die Klein-Felsenburger Tafeln entziffern konnte; dies gelang ihm jedoch nicht, so dass er sie unentschlüsselt bei einem Gelehrten zurücklassen musste, der versprach, sie an die „vornehmsten Societäten der Künste und Wissenschaften in Europa“ zu senden. Gisanders Schlusswort orientiert den Leser noch über die Einschiffung Horns nach der Felsenburg und über die endgültige Redaktion der „Felsenburgische[n] Geschichtsschreibung“. ( WF III: 485–486)

Abb. 9: Titelblatt der Erstausgabe des 4. Teils der Wunderlichen Fata.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 8° Fab.Rom. VI, 2525 b.
© Verlag Zweitausendeins
Der vierte Teil der WF , der im Gegensatz zu den Teilen 2 und 3 von Schnabel nicht angekündigt wurde, bringt im Titelblatt, nach der bereits bekannten Fortsetzungsformel, in roten Antiqua-Grossbuchstaben den Namen der persisch-candaharischen Prinzessin Mirzamanda, deren Lebensgeschichte „fast ein Haupt-Stück der Felsenburgischen Geschichte“ ausmache. Dies unterstreicht das dreigeteilte Frontispiz, dessen grösstes und detailreichstes Bild ein schreckliches Ereignis im Leben der Mirzamanda darstellt, nämlich die Ermordung ihrer Mutter, die sie als ganz kleines Kind miterlebte.

Abb. 10: Szene aus dem Frontispiz des 4. Teils der Wunderlichen Fata .
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 8° Fab.Rom. VI, 2525 b.
© Verlag Zweitausendeins
Möglicherweise sollte das persische Element im Titel dem Leser signalisieren, dass in diesem Roman von Magie, Zauberei, Geisterbeschwörung und Ähnlichem die Rede sein würde,6 und tatsächlich durchziehen solche Phänomene nicht nur Mirzamandas Lebensgeschichte, sondern breiten sich über grosse Teile des vierten Bandes aus. Als eine Art Gegenkraft zu diesen heidnischen Praktiken mag man die zahlreichen, sich über viele Seiten ausdehnenden frommen Predigten, Kantaten, Gebete etc. des vierten Teils verstehen. Die Zaubereien und Geisterauftritte werden zwar jeweils als real erlebte Ereignisse geschildert, gleichzeitig aber implizit verurteilt, denn sie sind mit dem Fremden, mit Irrglauben und Aberglauben verbunden und gehen von der Insel Klein-Felsenburg aus; dort treibt einer der auf der Insel stationierten Portugiesen schwarze Magie, und dort strandet auch Mirzamanda als Schiffbrüchige – in Begleitung einer Teufelsanbeterin, die später in einer schauerlichen Spukszene vom Satan geholt wird.
Auf Klein-Felsenburg werden ausserdem portugiesische Spione entdeckt, die vermutlich etwas mit der späteren Belagerung und Bombardierung der grossen Insel durch portugiesische Kriegsschiffe zu tun haben. Die Felsenburger schlagen die Angreifer in die Flucht, doch das Bewusstsein der Gefährdung ihres Inselparadieses ist geweckt.
Das Ende des vierten Teils bildet der Brief eines unbekannten Gelehrten an die Felsenburger über die im dritten Band auf Urnendeckeln gefundenen rätselhaften Zeichen. Der Gelehrte deutet sie als Symbole für die Götzenbilder aus dem klein-felsenburgischen Tempel und beschreibt die von den Statuen dargestellten heidnischen Götter ausführlich in ihren Eigenschaften und Funktionen, die in ihrer Gesamtheit das System einer archaischen Naturreligion ergeben. Dieser Anhang, der ohne Kommentar und ohne jede Wertung das vierbändige Romanwerk abschliesst, scheint die engen Klammern der alles beherrschenden evangelisch-lutherischen Orthodoxie etwas zu lockern und den Blick auf eine uralte, gänzlich andere religiöse Auffassung zu erlauben.
2.2 Die Inseln im Südmeere
Die folgenden Angaben zu Inhalt und Aufbau von Oehlenschlägers Roman beziehen sich auf die deutsche Ausgabe von 1826, die in dieser Arbeit im Sinne einer Fokussierung auf die prozessuale Entwicklung des Werks generell als Ausgangstext und Basis für die weiteren Fassungen gewählt wurde. Diese Wahl steht im Widerspruch zu früheren Vorgehensweisen, denn bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts pflegten die Literaturwissenschaftler ihren Analysen die „Ausgabe letzter Hand“ eines Textes zugrundezulegen, die als endgültig abgeschlossene Werkfassung, sozusagen als Repräsentation des „letzten Willens“ eines Autors in Bezug auf sein Werk betrachtet wurde, eine Auffassung, die sich mit den neuen Ansätzen, wie sie z.B. von der New Philology, der Diskursanalyse oder den Intertextualitätskonzepten entwickelt wurden, grundlegend änderte: Die Sicht des Autors als „Herr über seinen Text“ wurde ersetzt durch die Idee einer Autorinstanz, die als Instrument der Textgenerierung fungiert und also keinen Willen, keine Intention besitzt, nach der geforscht werden kann; die gängige Vorstellung vom Werk als geschlossene, alle Vorstufen hierarchisch dominierende „Ausgabe letzter Hand“ wurde geöffnet auf einen Textbegriff hin, der die Dynamik, die Polyvalenz, die Instabilität und Unabgeschlossenheit eines textuellen Produktes in den Blick nimmt.1 Dieser Paradigmenwechsel legt nahe, jeweils den Erstdruck als Textgrundlage zu wählen, da er als Ausgangspunkt für alle späteren Fassungen/Varianten das Prozessuale der Textgenese einleitet und damit deren dynamischen Charakter wahrnehmbar macht. Freilich stellt sich hier die Frage, warum dann nicht auf das Manuskript – soweit noch vorhanden und auffindbar – als allererste, medial fassbare Stufe des Entstehungsprozesses zurückgegriffen wird. In der vorliegenden Arbeit erfolgt die Wahl des Erstdruckes als Grundlage für die durchgeführten Analysen vor allem im Hinblick auf die Möglichkeit der Rezeption, die in den meisten Fällen erst auf die Druckfassung reagieren kann, d.h. es ist die gedruckte Ausgabe, die eine öffentliche und damit erst literaturwissenschaftlich einzuschätzende Wirkung hervorzubringen vermag.2
Читать дальше