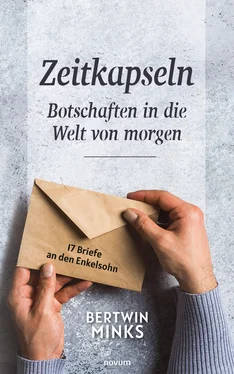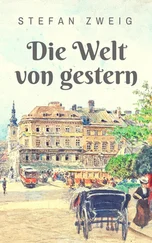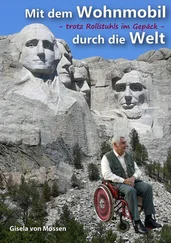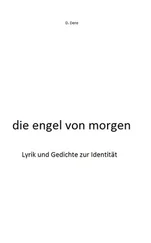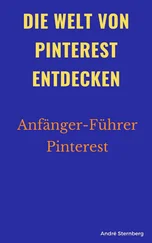2.2.1 Natürliche Ursachen des Treibhauseffektes
Auf dem Planeten Erde sind etwa 1.500–2.000 tätige kontinentale Vulkane bekannt. Dazu kommt ein noch viel größere, doch weitgehend unbekannte Anzahl submariner Vulkane. Dabei handelt es sich um Feuerberge, die in den letzten 10.000 Jahren mindestens einmal ausgebrochen sind. Ungefähr 40 bis 50 davon zeigen tägliche Aktivitäten, bei denen Staub, Kohlendioxid und andere Treibhausgase (vor allem schweflige und nitrose Gase) in die Atmosphäre emittiert werden. Dazu kommen Emissionen von klimawirksamen Gasen (hier vor allem Methan) bei Erd- und Seebeben. Physikalischen Abschätzungen zufolge sollen die Mengen an Kohlendioxid, die dabei in die Atmosphäre gelangen, für die Beeinflussung des Weltklimas vernachlässigbar sein. Sie werden auf etwa zwei Größenordnungen unter der Menge des anthropogen verursachten Anteils beziffert. Doch wer weiß, ob dieses Schätz-Ergebnis wissenschaftlich belastbar ist? Immerhin unterliegen vulkanische Aktivitäten mehr oder weniger starken Schwankungen. Außerdem dürfte die Erfassung der Aktivität submariner Quellen unvollständig sein. Darüber hinaus mag dahinstehen, ob die Klimarelevanz der bei Eruptionen freigesetzten Stäube und schwefligen Gase zu vernachlässigen ist.
Immerhin sind nach dem Ausbruch des Pinatobu (Philippinen 1991) die globalen Temperaturen vorübergehend um 1,5 °C gesunken. Nach dem Ausbruch des Tambora (Indonesien 1815) sollen es, Berechnungen zufolge, sogar 2,5 °C gewesen sein. Aufgrund der Zufälligkeit und Variabilität des Ausmaßes solcher geophysikalischen Ereignisse und ihrer unvollständigen Erfassung ist zu vermuten, dass sich deren Einfluss auf den irdischen Treibhauseffekt langfristig nicht zuverlässig einschätzen lässt und daher von den anthropogen verursachten Beiträgen auch nicht sicher abzugrenzen ist.
Ein anderes Szenario ergibt sich, wenn sogenannte Supervulkane ausbrechen oder supermassive effusive Ereignisse stattfinden. Die dabei freigesetzten Energien übersteigen diejenigen von „normalen“ Eruptionen um ein Vielfaches. Auf der Erde sind immerhin 20 bis 30 Vulkane mit einem Vulkanexplosionsindex (VEL) größer 7 (Supervulkane) bekannt, deren Ausbruchshäufigkeit zwischen 5.000 und 48.000 Jahren liegen soll. Die letzte Eruption eines solchen Vulkans hat vor 26.000 Jahren in Neuseeland stattgefunden. Die supermassiven effusiven Ereignisse, die beispielsweise die sibirischen oder die Dekkan-Traps in Indien geschaffen haben, liegen dagegen schon viele Millionen Jahre zurück. Das mag, was die Zeitspannen anbelangt, nicht besonders beunruhigend klingen. Die Menschen sollten sich jedoch bewusst sein, dass solche Ereignisse einschneidende Folgen für die jeweilige regionale Biosphäre und das globale Klima haben. Bei solchen verheerenden Ereignissen, können daher am Computer simulierte Klima-Prognosen schlichtweg hinfällig werden.
2.2.2 Anthropogene Quellen von Treibhausgasen
Der von den Menschen verursachte Eintrag von klimawirksamen Gasen in die Atmosphäre ist vielfältig, unbestritten und nimmt ständig zu. Das ist bei einer dramatisch wachsenden Weltbevölkerung und ihren zunehmenden ubiquitären Bedürfnissen aber auch zu erwarten. Die Hauptquellen betreffen die Energieerzeugung (ca. 40 %). Dabei handelt es sich vor allem um Kraftwerke, die fossile Energieträger (z. B. Kohle, Öl, Gas) verbrennen.
Ein weiterer relevanter Emittent ist der weltweite Land-, Wasser- und Luftverkehr, der auf der Nutzung von Kohlenwasserstoffen und ihren Produkten beruht. Aber auch gewerbliche Bereiche sowie Industrie und Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sind nicht zu vernachlässigende Emittenten von Treibhausgasen. Darüber hinaus müssen in diesem Zusammenhang auch urbane CO2-Quellen, die auf der Nutzung von Kohle, Öl oder Gas basieren (z. B. Heizungen, Verbrauchseinrichtungen) erwähnt werden. Die im globalen Maßstab anthropogen erzeugten Treibhausgase lassen sich mengenmäßig einigermaßen zuverlässig abschätzen. Doch die Beurteilung, in welchem Verhältnis die anthropogenen Emissionen zu dem Eintrag natürlicher Quellen in die Atmosphäre stehen, bleibt aufgrund von deren unvollständiger Erfassung, stochastischer Aktivitäten und erheblicher Intensitätsschwankungen unsicher und prinzipiell problematisch!
2.3 Geotektonische Prozesse
Die Plattentektonik mit der Spreizung ozeanischer Böden in den mittelozeanischen Rücken und deren Subduktion in Tiefseegräben sowie der Auffaltung von Gebirgen in Kollisionszonen kontinentaler Platten hat das globale Klima in allen Erdzeitaltern entscheidend gestaltet und geprägt. Die geotektonischen Prozesse scheinen einem Muster zu folgen, das der Wilson-Zyklus beschreibt. Danach werden Superkontinente zerfallen und sich dann erneut zu einer großen Landmasse vereinigen. In den vergangenen Erdzeitaltern vom Präkambrium bis zum Perm sollen sich mindestens drei solcher Superkontinente gebildet haben, die später wieder in einzelne Kontinentalplatten zerbrochen sind:
Rodinia vor ca. 1,1 bis 0,8 Milliarden Jahren
Pannotia vor ca. 650 bis 550 Millionen Jahren
Pangaea vor ca. 300 bis 250 Millionen Jahren
Die plattentektonischen Prozesse des Wilson-Zyklus wirken auch in der Zukunft fort. So soll in etwa 150 bis 200 Millionen Jahren wieder ein Superkontinent entstehen, dem die Menschen bereits den Namen Amasio gegeben haben.
Die Drift der Kontinente hat zwar einen maßgeblichen und langfristigen Einfluss auf die Klimageschichte des Planeten, da die Verteilung von Landmassen und die Struktur der Meere mit ihren transozeanischen Strömungen auf der Erdoberfläche völlig umgestaltet werden. Diese geotektonischen Prozesse erstrecken sich jedoch über einen Zeitraum, der sich nach Millionen von Jahren bemisst. Für retrospektive Klimaanalysen oder prospektive Aussagen, die nur wenige Jahrhunderte oder Jahrtausende umfassen, spielt der Einfluss dieser geophysikalischen Prozesse daher praktisch keine Rolle.
2.4 Transozeanische Strömungen
Transozeanische Strömungen und damit verbundene Phänomene Grundsätzlich werden diese unsichtbaren Straßen im Meer langfristig von der Plattentektonik geformt, verändert und meistens radikal umgestaltet. Doch diese Strömungen unterliegen auch kurzzeitigen Veränderungen. Wenn sich beispielsweise der Wärmehaushalt der Ozeane durch Vereisungs- und Abschmelzungsvorgänge oder anderweitige Abkühlungen und Erwärmungen ändert, werden Dichteschwankungen im Salzwasser erzeugt, die die Tiefenwasser-Zirkulation beeinflussen. Dieser Effekt kann sich auf den Verlauf, die Temperatur und die Intensität von Meeresströmungen auswirken. Demzufolge können beispielsweise der Golfstrom, der Humboldtstrom, die äquatorialen Ströme und deren Gegenströme auch in überschaubaren Zeiträumen das globale Klima unter Umständen sogar drastisch (z. B. Erlahmen des Golfstroms) beeinflussen.
Die Veränderung der Temperaturprofile, der Intensität und der Geschwindigkeit transozeanischer Strömungen gehen mit Phänomenen wie El Nino, La Nina oder der (ozeanischen) positiven oder negativen transatlantischen Oszillation einher. Obwohl diese Phänomene lokal auftreten und zeitlich begrenzt sind, können sie in ihrer Gesamtheit die Komplexität und Periodizität des globalen Klimas auch relativ kurzfristig und länger andauernd beeinflussen.
2.5 Astronomische Ursachen
Himmelsmechanische Prozesse verändern die auf der Erde eintreffende Sonneneinstrahlung über die jährlichen Schwankungen hinaus und führen zu einer langperiodischen Variation des Solarparameters. Die zeitvarianten Muster der Veränderungen resultieren aus drei sich überlagernden Änderungen der Parameter von Erdbahn und Erdachse. Dabei handelt es sich um folgende astronomische Effekte:
eine Präzession der Erdrotationsachse (Zyklus 28.000 Jahre) und eine Präzession der Perihel-Drehung der Erdbahn (Zyklus 112.000 Jahre)
Читать дальше